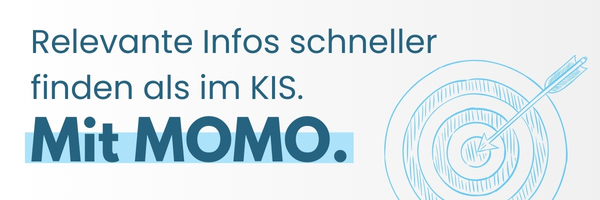Bundessozialgericht aktuell: Vergütung einer ambulanten Geburt und Verzugszinsen für Aufwandspauschalen
In seinen ersten Verhandlungsterminen im Jahr 2025 hat das Bundessozialgericht am 20. Februar entschieden, dass eine ambulante Geburt mit der Mindest-Fallpauschale zu vergüten ist (B 1 KR 6/24 R). Darüber hinaus hat es entscheiden, dass auf eine Aufwandspauschale Verzugszinsen zu zahlen sind (B 1 KR 15/24 R).
- MD
von André Bohmeier MHMM und Julia Zink, LL.M. MHMM
1. Vergütung einer ambulanten Entbindung – B 1 KR 6/24 R
Ambulante Entbindungen im Sinne des § 24f Satz 2 SGB V werden mit der Mindest-Fallpauschale vergütet.
1.1 Sachverhalt und Entscheidung
Dem Revisionsverfahren lag eine ambulante Entbindung gemäß § 24f Satz 2 SGB V im KH der Klägerin zugrunde. Die Patientin wurde zwischen 02.51 Uhr und 9.00 Uhr im Kreißsaal versorgt, wobei die Geburt um 04.01 Uhr erfolgte. Um 5.00 Uhr früh unterschrieb sie eine „Erklärung zur ambulanten Geburt“, womit sie bestätigte, das KH 4 Stunden nach der Geburt wieder verlassen zu wollen. Die KH rechnete die Entbindung als stationäre Versorgung mit der DRG 060D gegenüber der beklagten KK ab. Die KK verweigerte die Vergütung mit der Begründung, dass der Aufenthalt 24 h nicht überschritten habe und es daher an der physischen und organisatorischen Eingliederung in das spezielle Versorgungssystem des Krankenhauses gefehlt habe. Demnach habe keine Aufnahme stattgefunden, weswegen es sich um eine ambulante Entbindung gehandelt habe.
Das Sozialgericht (SG) hat die Klage des KH mit der Begründung abgewiesen (SG Dresden, Urt. v. 23.07.2020, S 47 KR 1233/17), dass eine ambulante Entbindung über die EBM-Ziffer 08411 abrechenbar und nach dem übereinstimmenden Willen der Erklärungen von KH und Patientin auch eine ambulante Entbindung erfolgt sei. Das Landessozialgericht (LSG) hat die dagegen gerichtete Berufung des KH zurückgewiesen (LSG Chemnitz, Urt. v. 13.12.2023, L 1 KR 449/20). Es ging dabei davon aus, dass die von der Rechtsprechung im Rahmen des § 39 SGB V Kriterien zur Beurteilung, ob eine Aufnahme stattgefunden habe auch auf die Entbindung anwendbar seien. Danach habe keine Integration stattgefunden, da die Patientin lediglich im Kreißsaal versorgt wurde, aber nicht auf die Wöchnerinnenstation aufgenommen worden sei. Daneben seien die spezifischen Mittel des KH auch nicht für die Patienten geblockt worden. Das alleinige „Sowieso“-Vorhalten einer Sectiobereitschaft sei hierfür nicht ausreichend. Die Versorgung des Neugeborenen begründe daneben auch keine Aufnahme. Schließlich sei auch keine analoge Anwendung der stationären Vergütungsregelungen auf eine ambulante Geburt gerechtfertigt.
Das BSG hat der Revision stattgegeben, die Entscheidungen der Instanzgerichte aufgehoben und die KK zur Zahlung der abgerechneten DRG verurteilt. Rechtsgrundlage des Vergütungsanspruchs für das KH sei unmittelbar § 24f SGB V. Dabei unterscheide sich die ambulante Entbindung in der Kernleistung nicht von einer stationären. Denn die Vorbereitungen, die eigentliche Entbindung unter Mitwirkung von Ärzten und Hebammen und die unmittelbare Nachsorge im Kreißsaal fallen bei einer ambulanten Entbindung in gleicher Weise an, wie bei einer komplikationslos verlaufenden stationären Entbindung. Da der Gesetzgeber keine Vergütungsregelung für die ambulante Entbindung normiert habe, könne daraus nur geschlossen werden, dass die für eine stationäre Entbindung abzurechnende Mindest-Fallpauschale auch für die ambulante Entbindung anfällt.
1.2 Einordnung und praktische Folgen
Entbindung ist keine Krankenbehandlung, sondern eine Versorgung eigener Art. Diesen Grundsatz hat der Gesetzgeber 2012 mit der Überführung der Regelungen zur Entbindung aus der Reichsversicherungsordnung in die §§ 24c bis 24i SGB V, also außerhalb des § 39 SGB V noch einmal klargestellt. Gemäß § 24f Satz 1 SGB V haben Versicherte Anspruch auf ambulante oder stationäre Entbindung. Nach Satz 2 kann die ambulante Entbindung in den dort bezeichneten Einrichtungen, unter anderem auch im Krankenhaus stattfinden. Im Falle einer stationären Aufnahme, also einer stationären Entbindung erfolgt die Vergütung über die einschlägige Fallpauschale. Hingegen ist für eine ambulante Entbindung bislang keine spezielle Vergütungsregelung vorgesehen.
Im Lichte dieser Rechtslage musste das BSG nun zwei Hauptfragen klären, nämlich 1. handelte es sich um eine stationäre Entbindung mit der Folge einer Vergütung nach der abgerechneten Fallpauschale und falls nicht, 2. welche Vergütung fällt für eine ambulante an?
Zunächst hat das BSG keine stationäre Entbindung erkannt. Hierzu ist der Senat zunächst davon ausgegangen, dass die zur Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V entwickelten Kriterien zur Abgrenzung stationäre oder ambulante Behandlung auch für die Entbindung heranzuziehen sind. Die Frage Abgrenzung ambulant/stationär ist seit der sog. Schockraum I Entscheidung verstärkt in den Fokus der Rechtsprechung zurückgekehrt. Ausschlaggebend für eine stationäre Qualifikation ist nach Auffassung des Gesetzgebers die physische und organisatorische Eingliederung des Patienten in das spezifische Versorgungssystem des Krankenhauses (BT-Drucks 12/3608, S. 82, zu § 39 SGB V). Hierfür muss eine Aufnahme des Patienten in das Krankenhaus erfolgen. Dies ist der Fall, wenn der Patient die besonderen Mittel des Krankenhauses – ständige ärztliche Verfügbarkeit, Pflege, Kost und Logis – auch tatsächlich in Anspruch nimmt. Davon ist zunächst bei einer Behandlungsdauer von einem Tag und einer Nacht auszugehen. Entscheidend ist dabei, dass der Krankenhausarzt die Entscheidung zur Aufnahme getroffen hat. Die Aufnahmeentscheidung auf der Basis eines entsprechenden Behandlungsplans wird nach außen regelmäßig durch die Einweisung auf eine bestimmte Station, Zuweisung eines Bettes oder das Erstellen entsprechender Aufnahmeunterlagen und ähnliches dokumentiert. Eine einmal getroffene Aufnahmeentscheidung entfällt nicht rückwirkend, etwa indem ein Versicherter gegen ärztlichen Rat auf eigenes Betreiben das Krankenhaus noch am selben Tag wieder verlässt, oder sich die Entscheidung aufgrund erst später erkennbarer Umstände rückblickend als unzutreffend erweist (BSG, Urt. v. 18.05.2021, B 1 KR 11/20 R, Rdnr. 11 ff. m.w.N. „Schockraum I“). Im Falle der Aufnahme eines Notfalls wird die Aufnahmeentscheidung konkludent getroffen. Bei einer kurzzeitigen Notfallbehandlung mit zeitnaher Verlegung liegt eine Aufnahme vor, wenn der Einsatz der krankenhausspezifischen personellen und sächlichen Ressourcen im erstangegangenen Krankenhaus eine hohe Intensität aufweist (BSG, Urt. v. 29.08.2023, B 1 KR 15/22 R „Schockraum II“). Wobei die Inanspruchnahme der besonderen Mittel des Krankenhauses auch dann vorliegt, wenn diese während der Durchführung einer ärztlichen Behandlung wegen des damit verbundenen Risikos schwerwiegender Komplikationen für die Versicherte exklusiv vor- und freigehalten werden (BSG, Urt. v. 20.03.2024, B 1 KR 37/22 R).
Auf der Grundlage dieses Maßstabs hat der Senat keine Aufnahme in das Versorgungssystem des Krankenhauses erkannt. Welcher Umstand dafür ausschlaggebend war, werden die noch nicht veröffentlichten Entscheidungsgründe zeigen. Vermutlich wird es jedoch an der diesbezüglichen ärztlichen Entscheidung fehlen.
Für eine ambulante Entbindung hat das BSG einen unmittelbaren Vergütungsanspruch des KH aus § 24f SGB V dem Grunde nach erkannt. § 24f SGB V normiert dabei zunächst den Versorgungsanspruch der Versicherten. Spiegelbildlich mit dem Anspruch der Versicherten erwächst dann der Vergütungsanspruch des Krankenhauses dem Grunde nach. Dies entspricht der Systematik der Krankenhausbehandlung nach § 109 Abs. 4 Satz 3 und § 39 SGB V, für die der Gesetzgeber ebenfalls keinen ausdrücklichen Vergütungsanspruch normiert hat.
Ebenso konsequent und sachdienlich ist die Feststellung des Senats zur Höhe der Vergütung in Form der Mindest-Fallpauschale. Denn mit der Fallpauschale wird der Aufwand für den Einsatz der besonderen Mittel des Krankenhauses bemessen und vergütet. Vor diesem Hintergrund unterscheiden sich ambulante und eine komplikationsfreie stationäre Geburt nur unwesentlich. In beiden Fällen kommen die besonderen Mittel in Form der ärztlichen, pflegerischen und die Versorgung durch eine Hebamme im vergleichbaren Umfang zum Einsatz. Die stationäre Entbindung überschießt ggf. lediglich, was die Aspekte Verpflegung und Unterkunft anbelangt. Diese fallen nach der Erläuterung des Senats in der mündlichen Verhandlung jedoch nicht ins Gewicht.
Die Entscheidung ist zu begrüßen, da für Geburtskliniken nun ein rechtssicherer Weg zur Abrechnung ambulanter Entbindungen vorgegeben ist.
2. Verzugszinsen auf Aufwandspauschale
Mit der Entscheidung B 1 KR 15/24 R hat das BSG klargestellt, dass nicht nur Prozess- sondern auch Verzugszinsen auf die Zahlung einer AWP anfallen. Für den Beginn des Verzugs nach Fälligkeit gilt dabei nicht die 30-Tage-Frist. Voraussetzung für den Beginn ist eine entsprechende Mahnung oder die endgültige Zahlungsverweigerung der KK.
2.1 Sachverhalt und Entscheidung
Gegenstand des Verfahrens B 1 KR 15/24 R war die Frage, auf welcher rechtlichen Grundlage und ab welchem Zeitpunkt Verzugszinsen auf die Forderung einer Aufwandspauschale zu zahlen sind.
Dem Revisionsverfahren lag eine Sprungrevision einer Entscheidung des SG Regensburg zugrunde (Urt. v. 11.01.2024, S 8 KR 341/22). In dem Verfahren stritten das klagende Krankenhaus (KH) und die beklagte Krankenkasse (KK) um eine Aufwandspauschale (AWP), nachdem die eingeleitete Prüfung zu keiner Minderung des Abrechnungsbetrages geführt hatte. Nachdem das KH Klage auf Zahlung der AWP erhoben hatte, zahlte die KK die AWP und die seit der Klageerhebung angefallenen Prozesszinsen aus „prozessökonomischen Gründen“. Zudem erklärte sich die KK bereit, die Kosten des Rechtsstreites zu tragen. Allerdings erklärte sie aber auch, dass die Zahlung kein Anerkenntnis darstelle. Streitig blieben dann nur noch die Verzugszinsen für den Zeitraum ab Fälligkeit der AWP bis zur Klageerhebung.
Das SG hat die KK zur Zahlung der Verzugszinsen auf Grundlage der § 69 Abs. 1 Satz 3 SGB V in Verbindung mit § 288 Abs. 1 Satz 1 BGB verurteilt. Dabei ging es davon aus, dass die Verweisnorm des § 69 Abs. 1 Satz 3 SGB V in Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) greift, da keine spezielleren Vorschriften entgegenstehen und die Verzugsregelungen des BGB den Vorgaben des § 70 SGB V und den Aufgaben und Pflichten der Krankenkasse nicht entgegenstünden. Die KK habe sich gemäß § 286 Abs. 3 Satz 1 SGB V auch in Verzug befunden, nachdem sie die Zahlungsfrist von 30 Tagen seit Fälligkeit verstrichen war. Dabei sei die Fälligkeit mit dem Zugang des MD-Gutachtens beim KH eingetreten. Daneben sei der Verzug auch gemäß § 286 Abs. Abs. 3 Satz 1 SGB V in dem Zeitpunkt eingetreten, in dem die Kasse die Zahlung der AWP endgültig verweigert hatte (via DTA-Nachricht und telefonisch). Dabei betrage der Zinssatz 5 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz gemäß § 288 Abs. 1 Satz 2 BGB. Gegen diese Entscheidung legte die KK die Sprungrevision ein.
Die Revision war insofern erfolgreich, als das BSG das Urteil aufgehoben und die Sache an das SG zurückverwiesen hat. Dabei bestätigte das BSG, dass Verzugszinsen auch für AWP anfallen können und die Verzugsregelungen des BSG über die Verweisnorm des § 69 Abs. 1 Satz 3 SGB V anwendbar seien. Die AWP sei aber nicht als Entgeltforderung im Sinne des § 286 Abs. 3 Satz 1 zu qualifizieren, so dass die Fälligkeitsregelung von 30 Tagen nach Satz 2 nicht anwendbar sei. Der Verzug könne daher allenfalls gemäß den Voraussetzungen des § 286 Abs. 1 oder 2 BGB eintreten. Voraussetzung dafür sei aber, dass ein Anspruch auf Zahlung der AWP überhaupt entstanden und die diesbezügliche Fälligkeit eingetreten sei. Zu beiden Aspekten habe das SG aber keine hinreichenden Feststellungen getroffen, weswegen unklar sei, ob die Vollzugsvoraussetzungen vorliegen. Die alleinige Übersendung des MD-Gutachtens an das KH sei jedenfalls nicht als Leistungsentscheidung zu qualifizieren.
2.2 Einordnung und praktische Folgen
Mit der Einführung der Aufwandspauschale durch das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz zum 01.04.2007 hat der Gesetzgeber einen veritablen Zankapfel in die ansonsten partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit der Selbstverwaltungsparteien geworfen, wobei wesentliche Aspekte erst im Laufe der Jahre durch die höchstrichterliche Rechtsprechung konkretisiert werden mussten. Unterdessen steht fest, dass der Anspruch auf die AWP in dem Zeitpunkt entsteht, sobald eine Abrechnungsminderung bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise jedenfalls faktisch ausgeschlossen ist (B 1 KR 23/23 R, Rdnr. 13), es sich um keinen Vergütungsbestanteil, sondern einen pauschalierten Schadensersatz handelt (B 1 KR 32/22 R, Rdnr. 22) und dennoch aber die kurze zweijährige Verjährungsfrist gilt (Rdnr. 40). Im Falle eines Rechtsstreits über das Ergebnis des Prüfverfahren ist die rechtskräftige Entscheidung des Gerichts maßgeblich und nicht die des MD (B 1 KR 24/14 R, Rdnr. 10). Der Anspruch ist jedoch ausgeschlossen, wenn das Krankenhaus das Prüfverfahren durch eine fehlerhafte Kodierung (B 1 KR 1/10 R, Rdnr. 11) oder Informationspflichtverletzung (B 1 KR 11/22 R, Rdnr. 13) veranlasst hat.
Mit der hier gegenständlichen Entscheidung steht nun auch fest, dass Verzugszinsen für die AWP anfallen können. Dabei ist zwischen Verzugszinsen bis zum Beginn eines Rechtsstreits und den ab der Erhebung der Klage anfallenden Prozesszinsen nach § 291 BGB zu unterscheiden. Ursprünglich war das BSG der Auffassung, dass für eine AWP lediglich Prozesszinsen anfallen, mangels vertraglicher Vereinbarungen aber keine Verzugszinsen für den davorliegenden Zeitraum seit Fälligkeit der Forderung (B 1 KR 24/14 R, Rdnr. 14). Diese vorhergehende Rechtsprechung hat der 1. Senat nun aufgegeben, womit nunmehr bereits die Fälligkeit den zeitlichen Beginn des Verzugs markiert.
Dabei tritt die Fälligkeit ein, sobald der Anspruch auf die AWP durchgesetzt werden kann. Dies ist der Zeitpunkt indem bei wirtschaftlicher Betrachtung faktisch feststeht, dass keine Erlösminderung bestehe. Diese Zäsur dürfte regelmäßig mit dem Zugang der Leistungsentscheidung eintreten, sofern die Parteien nicht über das Prüfergebnis streiten. Der alleinige Zugang des MD-Gutachtens reicht hierfür noch nicht aus, wie das BSG nun festgestellt hat; notwendig ist vielmehr eine ausdrückliche leistungsrechtliche Entscheidung.
Davon zu unterscheiden ist der Zeitpunkt des Verzugsbeginns nach Eintreten der Fälligkeit. Dazu hat die durch den Senat getroffenen Feststellung, dass die AWP keine Entgeltforderung im Sinne des § 286 Abs. 3 Satz 1 BGB ist, zur Folge, dass die 30-Tage-Regelung nach Satz 3 keine Anwendung findet. Dementsprechend beginnt der Verzug nach Zugang einer entsprechenden Mahnung des KH nach Fälligkeit bei der KK (§ 286 Abs. 1 BGB), oder nachdem die KK die Zahlung der AWP endgültig verweigert hat (§ 286 Abs. 2 Nr. 3 BGB).
Fachanwalt für Medizinrecht
Master in Health and Medical Management
Fachanwältin für Medizinrecht
Master in Health and Medical Management
Johannstraße 37
40476 Düsseldorf
info@zink-mediznrecht.de
www.zink-medizinrecht.de
zink-medizinrecht.de

Gebündelt, stets aktuell und immer handverlesen werden alle Neuigkeiten gesammelt und anwenderbezogen aufbereitet.