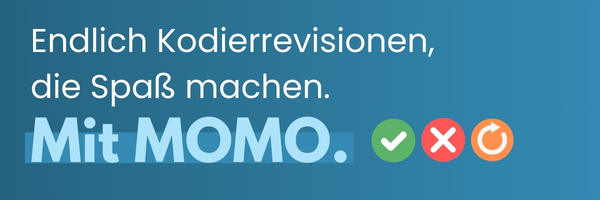Datenlücken, Fehlanreize und Kontrollwahn gefährden patientenzentrierte Versorgung
Ambulantisierung ja, aber bitte mit Substanz: IGES- und AOP-Modelle stützen sich auf lückenhafte Routinedaten. Ärztliche Entscheidungen geraten unter bürokratischen Druck. Die Folge: Versorgungslücken und Vertrauensverlust in ein System, das zunehmend auf Zahl statt Mensch setzt.
- Ökonomie
- QM
Eine Auswertung der Krankenhausabrechnungsdaten von 2022 zeigt ein theoretisches Ambulantisierungspotenzial von bis zu 21,8 %. Doch bei genauer Analyse verlieren die Modellrechnungen an Boden. Denn sie stützen sich auf DRG-Routinedaten, die zentrale Kontextfaktoren wie Pflegebedarf, soziale Umstände oder klinische Komplexität nicht abbilden. Diese Datenlücken führen zu problematischen politischen Ableitungen. Das Vertrauen auf internationale Mittelwerte wie die Bettenzahl pro 1.000 Einwohner verstärkt diese Verzerrungen zusätzlich. In Deutschland stehen immer weniger Pflegekräfte zur Verfügung, wodurch Betten real nicht mehr betrieben werden können, ohne dass dies systematisch erfasst würde. Gleichzeitig soll die ärztliche Entscheidung über die Behandlungsform zunehmend durch standardisierte Kontextfaktoren ersetzt werden. Das reduziert ärztliche Urteilskraft auf das Ausfüllen von Formularen. Statt echter Entlastung drohen neue Versorgungslücken, vor allem im ländlichen Raum. Die so entstehende bürokratische Logik entfernt sich vom Menschenbild einer patientenzentrierten Medizin. Besonders ältere, multimorbide und sozial vulnerable Patient:innen geraten ins Abseits. Ambulantisierung darf kein technokratisches Experiment sein, sondern braucht reale Versorgungsalternativen und klinischen Sachverstand.
laekh.de

Gebündelt, stets aktuell und immer handverlesen werden alle Neuigkeiten gesammelt und anwenderbezogen aufbereitet.