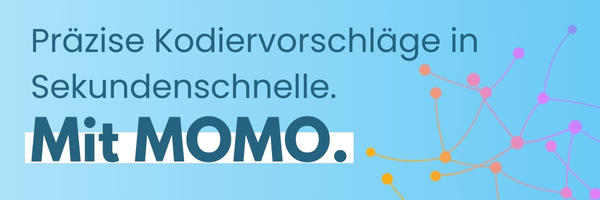Dr. KI übernimmt: Was digitale Diagnosetools wirklich leisten
Symptomchecker gelten als intelligentere Alternative zu Dr. Google – doch ihr Nutzen ist begrenzt. KI-basierte Systeme wie GPT-4 liefern teilweise bessere Diagnosen als Ärzte. Vertrauen ersetzt das aber nicht: Für medizinische Entscheidungen bleibt der Mensch gefragt.
- IT
- Medizin
Die Nutzung sogenannter Symptom-Checker nimmt zu. Immer mehr Menschen vertrauen bei Beschwerden auf digitale Diagnosewerkzeuge. Statt langer Suchergebnisse liefern diese strukturierte Antworten – oft mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Doch Tests wie der der Stiftung Warentest zeigen: Wirklich zuverlässig sind nur wenige Systeme. Zwei Programme überzeugten, andere fielen durch Fehleinschätzungen auf. So riet ein Checker bei banalen Symptomen zum sofortigen Arztbesuch, ein anderer erkannte schwere psychische Erkrankungen nicht. Die Pandemie hat die Instrumente bekannt gemacht, aber ihr medizinischer Mehrwert bleibt begrenzt. Auch Programme wie Symptoma stoßen an ihre Grenzen. Studien zeigen hingegen, dass Sprachmodelle wie GPT-4 zunehmend bessere Ergebnisse in der Diagnostik liefern – sogar Ärzte nutzen sie für Zweitmeinungen. Ein Problem bleibt die mangelnde Transparenz bei KI-gestützten Entscheidungen. Zudem fehlt vielen Systemen die Zulassung als Medizinprodukt. Mit der Gesundheitsreform in Österreich bekommt die digitale Selbstdiagnose neuen Schwung. Der politische Grundsatz lautet: Digital vor ambulant vor stationär“. Doch der Weg in den klinischen Alltag ist noch weit. Datenschutz, Qualität und der ärztliche Blick bleiben entscheidend. Künstliche Intelligenz wird ergänzen – nicht ersetzen…
futurezone.at

Gebündelt, stets aktuell und immer handverlesen werden alle Neuigkeiten gesammelt und anwenderbezogen aufbereitet.