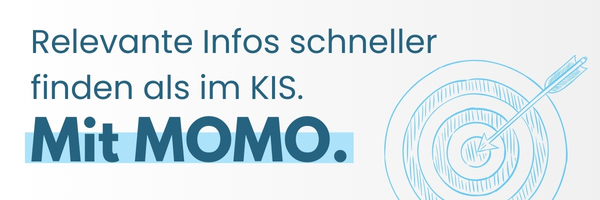Flensburg: KI rettet Leben, doch die Finanzierung fehlt
In Flensburg rettet Künstliche Intelligenz (KI) Schlaganfallpatient:innen wertvolle Lebenszeit, doch finanziert wird die Technologie nicht vom Gesundheitssystem, sondern durch einen Förderverein. Wichtige Innovationen hängen vom Engagement Einzelner ab, weil es an struktureller Finanzierung fehlt. Der Fall offenbart ein zentrales Dilemma im deutschen Klinikwesen. Fortschritt findet statt, aber nicht systematisch.
- IT
- Medizin
- Ökonomie
Im Flensburger Diako Krankenhaus unterstützt seit Kurzem eine KI-gestützte Software die Akutversorgung von Schlaganfallpatient:innen. Die Technologie wertet CT-Aufnahmen automatisiert aus, erkennt Gefäßverschlüsse und übermittelt innerhalb von drei Minuten präzise Empfehlungen zur Behandlung. Nach Einschätzung der behandelnden Radiolog:innen reduziert dies die Zeit bis zur Intervention um durchschnittlich 45 Minuten. In der neurologischen Notfallversorgung kann dieser Zeitvorteil über das Maß der Selbstständigkeit im späteren Alltag entscheiden.
Trotz der nachgewiesenen klinischen Relevanz wurde das System nicht über das Gesundheitssystem refinanziert. Weder die gesetzlichen Krankenkassen noch das Land Schleswig-Holstein beteiligen sich an den anfallenden Lizenzkosten. Die Finanzierung in Höhe von 120.000 Euro für drei Jahre übernahm ein neu gegründeter Förderverein. Getragen wird dieser zu großen Teilen durch regionale Unternehmen, insbesondere durch die VR Bank Nord, die rund 80 Prozent der Kosten bereitstellte.
Die Software kommt in beiden Flensburger Akutkrankenhäusern zum Einsatz, die gemeinsam etwa 1.200 Schlaganfallbehandlungen pro Jahr durchführen. Zehn Prozent der Fälle gelten dabei als schwerwiegend. Die Fallzahlen unterstreichen die Bedeutung eines schnellen, technologiegestützten Diagnoseverfahrens. Der Förderverein versteht sich als Impulsgeber für medizinische Innovationen, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der geplanten Zusammenführung der beiden Kliniken zu einem zentralen Neubau am Standort Peelwatt.
Das Beispiel Flensburg verdeutlicht, dass der Zugang zu moderner Medizintechnik zunehmend vom zivilgesellschaftlichen Engagement abhängt. Auch an anderen Standorten in Schleswig-Holstein wurden größere Geräteanschaffungen über Spenden realisiert, etwa zwei CTs auf Föhr oder ein neues MRT in Niebüll. Vor allem kleinere Häuser seien von Fördervereinen abhängig, weil die Investitionsmittel des Landes häufig nicht ausreichen.
Laut Angaben der Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein liegt der jährliche Investitionsbedarf der Kliniken im Land bei rund einer Milliarde Euro. Im Jahr 2024 stellte das Land 180 Millionen Euro zur Verfügung. Trotz steigender Mittel wird die Finanzierungslücke damit nicht geschlossen. Fördervereine können punktuell unterstützen, ersetzen aber keine strukturelle Investitionsstrategie. Der Vorsitzende des Fördervereins Flensburger Kliniken verweist auf das hohe Tempo medizinischer Innovation, dem das Finanzierungssystem nicht standhalten könne. Für das größte Krankenhaus des Landes, das UKSH, sind Spenden längst Teil der Strategie. Neben Forschung und Technik fördern sie auch psychosoziale Angebote wie Klinikclowns.
Die Diskussion um die Refinanzierung innovativer Technologien wie KI zeigt exemplarisch, welche Spannungsfelder sich zwischen technologischem Fortschritt, klinischem Bedarf und regulatorischer Trägheit im deutschen Gesundheitssystem auftun. Fachleute fordern deshalb eine schnellere Integration solcher Anwendungen in die Regelversorgung. Andernfalls bleibt medizinischer Fortschritt ein Privileg gut vernetzter Regionen und abhängig vom Engagement Einzelner.
NDR.de

Gebündelt, stets aktuell und immer handverlesen werden alle Neuigkeiten gesammelt und anwenderbezogen aufbereitet.