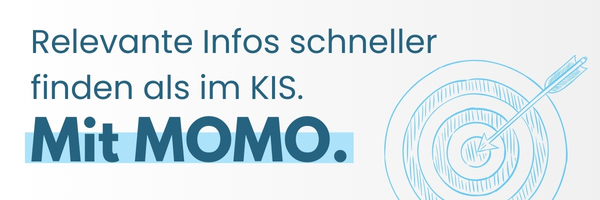Hybrid-DRG treiben die Ambulantisierung voran
Hybrid-DRGs
- Ökonomie
Seit 2024 treiben die die Ambulantisierung und verschieben die tektonischen Platten der Krankenhausvergütung. Die sektorenübergreifende Fallpauschale soll ambulante Operationen, die nur in Ausnahmefällen einen stationären Aufenthalt erfordern, in den ambulanten Bereich verlagern. Damit stehen Kliniken vor einer großen Herausforderung: Wer die Balance aus optimierten Leistungswegen, Deckungsbeitrag und Prozessqualität nicht beherrscht, gerät schnell in finanzielle Schwierigkeiten.
Definition und gesetzlicher Rahmen von Hybrid-DRGs
Die Hybrid-DRG ist eine sektorengleiche Vergütung nach § 115f SGB V. Sie gilt für ausgewählte Eingriffe und wird unabhängig davon gezahlt, ob ein Patient das Krankenhausbett nutzt oder abends wieder zu Hause ist. Grundlage hierfür sind das Krankenhauspflegeentlastungsgesetz 2022 sowie die Hybrid-DRG-Vergütungsvereinbarungen von BMG, DKG, KBV und GKV-Spitzenverband. Das Hybrid-DRG-Format folgt der politischen Intention der Kostendämpfung und sorgt erstmals für eine echte Verzahnung zwischen ambulantem und stationärem Sektor.
Leistungskatalog 2025 und Perspektive 2026
Der listet 22 Hybrid‑DRG mit 575 OPS‑Kodes. Neu sind zehn Pauschalen, etwa Arthroskopien von Sprunggelenken, laparoskopische Cholezystektomien und Lymphknotenbiopsien. Laut Vertragspartnern lassen sich damit bis zu 400 000 stationäre Fälle vermeiden. KBV und GKV planen bis 2026 einen Ausbau um weitere 100 OPS‑Kodes, darunter mehrere kardiologische Prozeduren. Politische Zielgröße 2026: eine Million Fälle pro Jahr.
Wirtschaftliche und organisatorische Aspekte des ambulanten Operieren am Krankenhaus
Vergütungshöhe
Hybrid‑DRG liegen nach bisherigen Erfahrungen im Schnitt 30 bis 40 % unter der stationären DRG und 15 % über der EBM‑Vergütung.
Kostenstruktur
Das Deutsche Krankenhausinstitut zeigt, dass ambulante Eingriffe im Krankenhaus (AOP) bei heutiger Struktur im Mittel um 34% unterdeckt sind. Haupttreiber: deutlich höhere Personalkosten, vollkommen andere Personalqualifikationen sowie eine nicht sachgerechte Vergütung der Sachkosten (DKG).
Zentral‑OP versus ambulantes OP-Zentrum (AOZ)
Ein Hybrid‑Eingriff im Zentral‑OP nutzt dieselbe Infrastruktur wie eine große Tumorresektion: Laminar‑Flow‑Saal, speziell ausgebildete OP‑Pflege in Drei‑Schicht‑Besetzung, Sterilogistik über Nacht. Diese, im stationären Setting notwendige „Luxusausstattung“ macht jede ambulante Operation unnötig teuer. Praxiserfahrungen zeigen einen Kostenvorsprung von rund 25 % für ein separat geführtes OP‑Zentrum. Komplizierte Überwachungen, pflegeintensive Nachbetreuungen und ein hoher Personaleinsatz, wie sie im Zentral-OP für Akut- oder Notfallpatienten regelmäßig erforderlich sind, sind hier nicht notwendig. Das AOZ kann also mit weniger Pflege-, OP- und Verwaltungspersonal auskommen und die Personalressourcen gezielter einsetzen. Die Abläufe im AOZ sind stringent standardisiert: Prä- und postoperative Wartezeiten werden minimiert, OP-Pläne können effizienter gestaltet werden und die Umsetzungszeiten zwischen den Operationen sind kürzer. Auch die laufenden Kosten für Verwaltung, Reinigung, Energieverbrauch und Geräte sind im AOZ in Relation zum Output günstiger, da sie exakt auf das ambulante Leistungsspektrum zugeschnitten sind..
Infrastruktur AOZ
Ein tragfähiges Zentrum folgt vier Prinzipien:
- Mono‑Funktion – nur AOP und Hybrid‑DRG.
- Kompakte Wege – Empfang, Umkleide, OP‑Säle und Aufwachraum bilden bestenfalls eine geschlossene Schleife auf kleinst möglichen Raum.
- Lean‑Team – Pro Saal agiert ein Facharzt Anästhesie und zwei OP‑Kräfte als festes Team. Operateure werden dienstleistungsbasiert zugebucht.
- Digitale Dokumentation – Check‑in per Tablet, schlanke standardisierte digitale Dokumentation mit direkter Anbindung an das Abrechnungssystem
Baulich reicht oft ein Umbau bestehender separater Neben‑OP‑Säle. Entscheidend ist ein eigener Zugangsweg, damit Patientenströme klar getrennt bleiben.
Patientensteuerung und Pfadtrennung
Ambulante und stationäre Patienten benötigen strikt getrennte Prozesspfade – von der Indikationssprechstunde bis zur Nachsorge:
- Vorauswahl – Die Fachabteilung prüft in der Indikationssprechstunde die AOP- oder Hybrid‑DRG Eignung anhand des OPS, der Kontextfaktoren, des ASA‑Status und der sozialen Umgebung.
- Triage – Ein zentrales Terminportal lenkt AOP- und Hybrid-DRG Fälle direkt in das ambulante Zentrum, während komplexe Fälle dem stationären Setting übergeben werden. Digitale Unterstützung finden Sie dabei z.B mit dem „MOMO Fallpilot„, einem Simulationstool zur Ermittlung der wahrscheinlichen Abrechnungsart bereits vor der elektiven Aufnahme.
- Synchronisation – OP‑Manager dirigieren die Tagesplanung von AOP- und Hybrid‑DRG Operationen der verschiedenen Fachrichtungen und sorgen so für eine optimale Auslastung der Strukturen.
- Rückfallebene – Ein Bettenpuffer in Abhängigkeit von der AOZ Größe hält den Notfallweg in die Station offen, falls Komplikationen auftreten.
Aufgaben für Controlling und OP-Management
Das legt das Einzugsgebiet fest, prüft die Fallzahlen und bestimmt das Ambulantisierungspotenzial je Fachgebiet. Es kalkuliert AOP- und Hybrid-DRG-Leistungen, vergleicht Erlöse mit den Prozesskosten und ermittelt den Deckungsbeitrag. Jahres- und Mehrjahrespläne zeigen den Investitions-, Betriebs- und Liquiditätsbedarf auf. Ein BI-gestütztes Berichtswesen meldet den monatlichen Leistungsmix standardisiert mit Erlösen, Kosten und Deckungsbeitrag im Vorjahres- und Planvergleich. Typische Kennzahlen wie OP-Auslastung, First Case On Time, Turnover Time sowie Komplikations- und Verlegungsquote steuern den Alltag. Regelmäßige Jour-Fixe mit den AOZ-Verantwortlichen verknüpfen Zahlen und Entscheidungen. Dashboards liefern die dafür notwendige Echtzeit-Transparenz..
Das ermittelt mit Controlling-Unterstützung den Bedarf an Eingriffen, Flächen und Technik. Es gestaltet die Raumstruktur, die Wegeführung und die Hygieneschleusen. Es wirkt bei der Beschaffung der OP-Ausstattung und der IT mit, rekrutiert Teams, plant Dienste und definiert SOPs von der Aufnahme bis zur Entlassung. Checklisten, das Critical Incident Reporting System (CIRS), die Sterilgut- und Medikamentenlogistik sowie ein KPI-Dashboard sichern die Qualität. Gemeinsam mit dem Controlling und dem Krankenhausmanagement überwacht es das Budget, die Fallkosten und die strategischen Ziele. Im laufenden AOP-Betrieb prüft das OP-Management alle Prozesse fortlaufend auf Hygiene-, Arbeitsschutz- und Datenschutzkonformität, steuert Audits und behördliche Abnahmen. Es überwacht die Tagesabläufe, passt die Kapazitäten an die Nachfrage an, treibt Lean-Projekte zur Reduktion der Wechselzeiten voran und organisiert Fortbildungen. So trägt es dazu bei, dass das Ambulante OP-Zentrum leistungsfähig, sicher und wirtschaftlich zugleich ist.
Fazit: Erfolgsfaktor Hybrid DRG 2025
Hybrid DRG sind der zentrale Hebel, um die Ambulantisierung im Krankenhaus nachhaltig voranzutreiben. Wer jetzt in schlanke AOZ-Strukturen, transparente Kalkulationen und datengestütztes OP-Management investiert, sichert sich nicht nur Deckungsbeiträge, sondern verschafft sich auch einen deutlichen Wettbewerbsvorteil. Nutzen Sie unseren Hybrid-DRG Praxis-Leitfaden 2025, um typische Kostenfallen zu vermeiden und Ihre Prozesse optimal auszurichten – so verwandeln Sie regulatorische Vorgaben in echte Chancen für Wirtschaftlichkeit und Patientenversorgung.
FAQ: Hybrid DRG 2025
1. Welche Eingriffe fallen 2025 unter die Hybrid DRG?
Der offizielle Hybrid-DRG-Katalog 2025 umfasst 22 Pauschalen mit insgesamt 575 OPS-Codes, darunter laparoskopische Cholezystektomie, Arthroskopien des Sprunggelenks und diagnostische Lymphknotenbiopsien. Für 2026 ist bereits eine Erweiterung um rund 100 weitere OPS-Codes – inklusive mehrerer kardiologischer Prozeduren – geplant.
2. Welche Kritikpunkte werden am Hybrid-DRG-Modell geäußert?
Kliniken und Fachverbände bemängeln vor allem:
- Finanzielle Unterdeckung: Die Vergütung liegt im Schnitt 30–40 % unter der stationären DRG und deckt bei heutigem Personal- und Sachkostenmix häufig nicht die Realkosten.
- Fixe Pauschalen trotz variabler Komplexität: Unterschiedliche Patient:innenrisiken oder Komorbiditäten werden nur begrenzt abgebildet, was zu Quersubventionierungen führen kann.
- Administrativer Mehraufwand: Doppeltes Dokumentieren (ambulant + stationär) sowie aufwendige Umwandlungsverfahren bei Komplikationen binden Ressourcen.
- Fehlanreize & Selektionsrisiken: Es besteht die Gefahr, dass im Niedergelassenen Bereich bevorzugt „risikoarme“ Fälle auswählt werden, während Patienten mit erhöhtem Risiko an Kliniken versorgt werden müssen und die Gesamtkosten dort steigen.
- Investitionsdruck: Der Aufbau schlanker AOZ-Strukturen erfordert zusätzliche Investitionen, die sich in der aktuellen Situation kaum ein Krankenhaus leisten kann.
3. Was passiert, wenn ein Patient nach der OP doch stationär bleiben muss?
Treten Komplikationen auf, lässt sich der Fall in eine stationäre DRG umwandeln. Die Klinik meldet den Wechsel elektronisch an die Krankenkasse, dokumentiert die medizinischen Gründe und erhält anschließend die reguläre DRG-Vergütung; die ursprüngliche Hybrid-DRG wird storniert. Ein geplanter Bettenpuffer und klare SOPs stellen sicher, dass dieser Übergang wirtschaftlich abgesichert und patientensicher erfolgt.
Autor: Michael Thieme, Ärzt. Leiter Medizincontrolling BKJL, Inhaber medinfoweb.de
Mannheim, den 17.07.2025
medinfoweb.de

Gebündelt, stets aktuell und immer handverlesen werden alle Neuigkeiten gesammelt und anwenderbezogen aufbereitet.