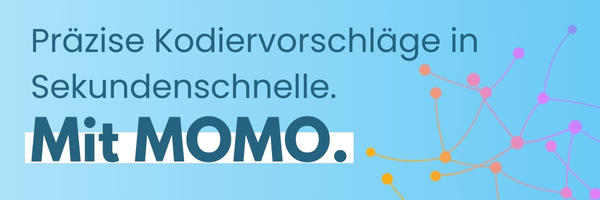Krankenhäuser sind keine freien Marktteilnehmer – Gesundheitseinrichtungen sind kein freier Markt und es gibt keinen freien Wettbewerb
Dr. Klaus Schulenburg, Referent für Krankenhauswesen beim Bayerischen Landkreistag, empfiehlt Klinikmanagern im Interview, Verbundlösungen von größeren und kleineren Häusern anzustreben
- Ökonomie
- Politik
Dr. Klaus Schulenburg, Referent für Krankenhauswesen beim Bayerischen Landkreistag, empfiehlt Klinikmanagern im Interview, Verbundlösungen von größeren und kleineren Häusern anzustreben, um den Wettbewerb um Personal nicht eskalieren zu lassen, und sich auf die vorzuhaltenden medizinischen Leistungen zu konzentrieren. Von medizinischer Qualität über Ausbildungskapazitäten bis zur wirtschaftlichen Bedeutung eines Krankenhauses für die Region – Schulenburg betont die strategischen Überlegungen hinter jeder Entscheidung. Er warnt vor möglichen „Geisterhäusern“ und betont die Wichtigkeit einer ausgewogenen, bedarfsorientierten Planung. Seine Einblicke bieten wertvolle Perspektiven für eine effektive und zukunftsorientierte Krankenhausstruktur.
Krankenhausreform – Krankenhausplanung nicht dem Zufall überlassen
Dr. Klaus Schulenburg ist Referent für Krankenhauswesen beim Bayerischen Landkreistag und seit 17 Jahren Mitglied im Krankenhausplanungsausschuss. Er ist ebenfalls Mitglied im Hauptausschuss der Bayerischen Krankenhausgesellschaft. Durch seine Erfahrung kennt er viele bayerische Krankenhäuser sowohl von innen durch Baumaßnahmen als auch von außen und hat einen umfassenden Überblick über die bayerische Krankenhauslandschaft.
Franka Struve-Waasner : Was sind die „weichen Faktoren“ von Krankenhäusern? Die medizinische Qualität steht an erster Stelle, aber es gibt auch andere Faktoren zu berücksichtigen?
Klaus Schulenburg : Aus der Sicht des Bundes und auch aus rechtlicher Sicht dreht sich im Wesentlichen alles um die medizinische Ergebnisqualität. Die Hauptsorge besteht darin, dass ein Patient ins Krankenhaus kommt, behandelt wird und gesund entlassen werden kann, ohne nachfolgende Komplikationen oder Operationen. Das ist das Hauptkriterium, auf das der Bund und das Sozialgesetzbuch abzielen. Dennoch gibt es noch andere Parameter, die nicht zu vernachlässigen sind. Krankenhäuser haben zusätzliche Funktionen in der regionalen Versorgung. Sie dienen oft als Anlaufstelle für Notfälle und gleichen Lücken in der ambulanten Versorgung aus, insbesondere in Regionen mit Ärztemangel. Es gibt auch weiche Faktoren wie die Qualität der Pflege und die Patientenzufriedenheit. Ein weiteres Beispiel ist die Essensqualität, die von Krankenhaus zu Krankenhaus stark variieren kann. All diese Aspekte müssen finanziert werden. Krankenhäuser sind komplexe Einrichtungen mit vielfältigen Auswirkungen auf die Regionen. Sie sind oft die größten Arbeitgeber in den Landkreisen und haben eine wirtschaftliche Bedeutung, die jedoch in der bundespolitischen Argumentation nicht berücksichtigt wird.
FS: Können Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung durch die Ausbildung von Pflegekräften und Ärzten punkten?
KS: Dieser Punkt wurde in den Diskussionen der Regierungskommission vernachlässigt, wird aber jetzt stärker berücksichtigt. Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung spielen eine wichtige Rolle als Ausbildungsstäten für Ärzte und Pflegekräfte. Sie bieten Pflege- und Krankenpflegeschulen oder neudeutsch: generalistische Pflegeschulen. Mit der Schließung von Krankenhäusern gehen auch Ausbildungskapazitäten verloren, besonders im ländlichen Raum. Dies hat Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von Fachkräften in diesen Regionen. Ähnliches gilt für Ärzte: Wenn die Ausbildung im ländlichen Raum fehlt, ist es schwierig, Ärzte dorthin zu bringen. Es wäre daher unklug, die Ausbildungs- und Fortbildungskapazitäten der Krankenhäuser einzuschränken.
FS: Welche Ratschläge würden Sie Krankenhausmanagern geben? Viele streben nach dem Status Level 2 und suchen Kooperationen mit größeren Krankenhäusern. Wie sollten Bauprojekte in Angriff genommen werden?
KS: Einige Bundesländer, wie das Saarland und Bremen, sollen dem Vernehmen nach ihre Planung von Krankenhausbauprojekten aufgrund der Unsicherheiten gestoppt haben. Bayern hat diesen Weg nicht eingeschlagen und wird ihn auch nicht gehen. Wir werden das sog. Vorwegfestlegungsverfahren für Krankenhausbaumaßnahmen fortsetzen. Wir erhalten weiterhin Anträge und berücksichtigen diese, jedoch nicht von Krankenhäusern, deren Zukunft ungewiss ist. Manche Krankenhäuser
spekulieren auf Level 2 und könnten letztendlich nur Level 1n erreichen. In solchen Fällen sollte nicht unnötig Steuergeld investiert werden. Krankenhausinvestitionsprogramme werden fortgesetzt, aber es ist ratsam, nicht überstürzt auf Level 2 zu setzen. Für einzelne Krankenhäuser mag dies sinnvoll sein, aber in Bezug auf die gesamte bayerische Krankenhauslandschaft sollten Krankenhausmanager abwarten. Die Versorgungslevel dienen eher der Transparenz. Es ist wichtiger zu überlegen, welche medizinischen Leistungen vorgehalten werden können.
FS: Aber für einzelne Häuser ergibt es Sinn…
KS: Die Personalproblematik ist entscheidend. Wenn jedes Krankenhaus versucht, der Stärkste zu sein, entsteht ein ungesunder Wetbewerb. Krankenhäuser sind jedoch keine freien Markteilnehmer. Gesundheitseinrichtungen sind kein freier Markt und es gibt keinen freien Wetbewerb. Die Krankenhäuser können auch nicht wie Unternehmen ihre Preise anpassen, wenn die Kosten über den Erlösen liegen. Unsere Empfehlung für Verbundlösungen ist der richtige Ansatz.
Schwerpunktkrankenhäuser sollten von kleineren Einrichtungen umgeben sein, die ein eigenständiges Leistungsportfolio aufweisen. Die Idee ist, dass Krankenhäuser in einem Verbund zusammenarbeiten. Der Fokus sollte auf Integration und Zusammenarbeit liegen, anstat sich gegenseitig zu übertrumpfen. Einzelne Häuser im Ballungsraum sollten nicht zwanghaft auf Level 2 setzen.
FS: Wie sollen die Krankenhäuser der verschiedenen Versorgungslevel zukünftig zusammenwirken? Nehmen wir das Universitätsklinikum Erlangen als Beispiel, das von kleineren Krankenhäusern umgeben ist.
KS: Neben einem Maximalversorger oder einem Universitätsklinikum ist ein Level 2-Haus im näheren Umgriff nicht zwingend erforderlich, aber die Situation kann individuell variieren. Die jeweilige Konstellation spielt eine wichtige Rolle. In Ballungsgebieten wie Erlangen oder München sollten umliegende Krankenhäuser auch eine gewisse medizinische Expertise aufweisen, nicht nur Beten bereitstellen. Diese Häuser dienen als Überlauf für die Großkrankenhäuser in den Ballungsregionen, wie es bei der Versorgung der Corona-Patienten deutlich wurde. Häten die kleineren Häuser nicht häufiger elektive Leistungen erbracht und leichtere Corona-Fälle behandelt, häten die größeren Häuser sich keinesfalls wie geschehen auf die schwereren Fälle konzentrieren können. Dieses Prinzip der kommunizierenden Röhren in einem gestuften Krankenhaussystem muss bei krankenhausplanerischen Maßnahmen berücksichtigt werden, auch um zukünftige Entwicklung zu berücksichtigen und Verbundlösungen zu unterstützen. Welche Krankenhäuser sollen welches Versorgungslevel haben? Die Entscheidung sollte strategisch sein, anstat auf Zufall zu setzen.
FS: Konkret: Wie sieht es aus für den Standort Ebermannstadt des Klinikums Forchheim-Fränkische Schweiz? Wäre das eine sinnvolle Forderung zu sagen, wir wollen hier ein integriertes Gesundheitsversorgungszentrum? (Anmerkung: Die Klinik Fränkische Schweiz (85 Betten) in Ebermannstadt fusionierte 2019 mit dem Klinikum Forchheim (230 Betten).)
KS: Für Ebermannsstadt gibt es zwei Szenarien: ein Level 1i- Haus oder ein Fachkrankenhaus für Psychosomatik. Die Geriatrie zieht um nach Forchheim. Man kann entweder versuchen ein Fachkrankenhausstatus zu entwickeln oder eine integrierte Versorgung.
Eine weitere Herausforderung in Bayern ist die Landarztproblematik der Niedergelassenen. Im südlichen Oberfranken ist die medizinische Versorgung noch weitgehend gegeben, aber wenn man in den Bayerischen Wald blickt, ins tiefste Mitelfranken oder ins nördliche Oberfranken, dreht es nicht mehr um die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum, sondern es geht um Medi Cubes (medizinische Kioske) oder MediBoxen wie in Frankreich. Die MediBoxen werden wie Telefonzellen an geeigneten Orten, etwa im Rathaus, in einer Apotheke oder einem Supermarkt aufgestellt, der
Patient verbindet sich mit verschiedenen Diagnosegeräten und dann wird der Arzt digital zugeschaltet. Bei den Medi Cubes von Helios werden die Patienten von einer medizinischen Fachangestellten (MFA) betreut und der Arzt wird ebenfalls nur noch digital zugeschaltet. In Frankreich läuft es zum Teil erfolgreich. Da sitzen die älteren Herrschaften in diesen Telefonzellen, stöpseln sich selbst an und der Arzt schaltet sich zu.
FS: Das ist sicher preiswert…
KS: In Bayern stellt sich die Frage, ob wir auch wirklich im ländlichen Raum die entsprechende Breitbandversorgung haben. Eine weitere Idee ist, über den mobilen 5G-Standard Patienten, die das Krankenhaus verlassen, mit Smartmetern zur Überprüfung ihrer Lebensparameter zu versorgen.
Heute ist es schon möglich, mit fünf bis sechs Parametern mit einer hohen Wahrscheinlichkeit einen Herzinfarkt vorherzusagen. Will man das für einen ganzen Landkreis machen, stellt sich aber ebenfalls die Frage, ob es den 5G-Standard flächendeckend gibt und ob der Server im Krankenhaus es überhaupt schaffl, quasi im Minutentakt Lebensparameter von Hunderten Patienten zu verarbeiten?
FS: Welche nächsten Schritte stehen bevor?
KS: Die Umstellung auf integrierte Leitstellen im Retungswesen ist eine Herausforderung. Die Notrufnummer für den Retungsdienst 112 soll mit der 116 117 des Bereitschaftsdienstes der Kassenärztlichen Vereinigung kombiniert werden. Dies erfordert jedoch nicht nur technische Anpassungen, sondern mitelfristig auch die Integration von Disponenten und Personal in den Leitstellen. Bei der Krankenhausreform wäre es enorm wichtig, wenn die strukturellen Auswirkungen auf die notfallmedizinische und die ambulante ärztliche Versorgung mitbedacht würden. Hier müsste der Gesetzgeber bzw. das Bundesgesundheitsministerium zeitnah ebenfalls Vorschläge machen.
FS: Prof. Dr. Boris Augurzky, Kompetenzbereichsleiter Gesundheit im RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung und Mitglied der Regierungskommission, spricht von Geisterhäusern, weil die Krankenhäuser nach der Corona-Pandemie eine geringere Auslastung fahren.
KS: Geisterhäuser sind eine ernsthafte Gefahr. Über Level 1i wird viel gesprochen. Diese Häuser sollen integrierte intersektorale Gesundheitszentren sein, die schon länger diskutiert werden. Sie bieten stationäre und ambulante Dienstleistungen, wie z.B. Diagnostik. Die Umsetzung ist komplex, da es viele rechtliche und strukturelle Hürden gibt. Es ist nicht ratsam, viele kleine Krankenhäuser zu Level 1i-Häusern umzuwandeln und dadurch die notfallmedizinische Komponente zu verlieren. Die Wege im Notfall würden zu lang werden.
FS: Aber gibt es im Rettungswagen nicht schon gute Hilfe?
KS: Die neuen Retungsassistenten leisten gute Arbeit. Dennoch gibt es standespolitische Probleme. In Deutschland gibt es eine starke Trennung zwischen ärztlichen und nichtärztlichen Leistungen. Ärzte sind oft gegen eine Delegation von ärztlichen Aufgaben an Retungsassistenten oder auch an Pflegekräfte. Diese Konflikte sind in Deutschland oft hinderlich für Reformen.
FS: Vielen Dank für das Interview.
Franka Struve-Waasner hat knapp sechs Jahre als Pressesprecherin für das Klinikum Forchheim-Fränkische Schweiz gearbeitet. Nach ihrerTätigkeit als Referentin für Kommunikation am Klinikum Neumarkt ist sie nun freiberuflich tätig im Bereich Öffentlichkeitsarbeit für Krankenhausanalyse-Unternehmen (BinDoc GmbH) und Krankenhausabrechnungsdienstleister (DRG-Control).
Franka Struve-Waasner

Gebündelt, stets aktuell und immer handverlesen werden alle Neuigkeiten gesammelt und anwenderbezogen aufbereitet.