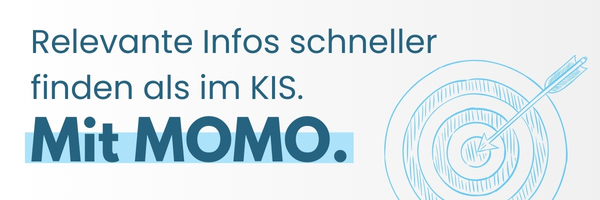Krankenhauslandschaft in Niedersachsen steht vor tiefgreifenden Veränderungen
Niedersachsens Gesundheitsminister Dr. Andreas Philippi im Gespräch mit Mitgliedern des Verbands der Privatkliniken Niedersachsen und Bremen…
- Politik
- Ökonomie
Hannover. Die Krankenhauslandschaft in Niedersachsen steht vor tiefgreifenden Veränderungen, wie Niedersachsens Gesundheitsminister Dr. Andreas Philippi im Rahmen einer Veranstaltung in Hannover sagte, zu der der Verband der Privatkliniken Niedersachsen und Bremen eingeladen hatte.
Mit dem Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG) und dem Krankenhausreformanpassungsgesetz (KHAG) habe der Bund einen Paradigmenwechsel eingeleitet – mit dem Ziel einer bedarfsgerechteren Ausrichtung gerade auch im ländlichen Raum.
Der Minister gab einen Überblick zum aktuellen Thema Leistungsgruppen-Einordnung der Krankenhäuser als zentraler Bestandteil der aktuellen Krankenhausreform in Deutschland. Sie klassifizieren medizinische Leistungen, um Krankenhäuser zu spezialisieren und die Qualität der Versorgung zu verbessern. Jedes Krankenhaus erhält einen Versorgungsauftrag für bestimmte Leistungsgruppen, um eine effektivere Behandlung zu ermöglichen.
Die Leistungsgruppen-Einordnung befinde sich gerade in einer entscheidenden Phase, so der Minister. Es habe gerade eine erste Sichtung der eingereichten Leistungsgruppenanträge gegeben.
Viele Krankenhäuser hätten sich auf den Weg gemacht und erörtert, wie mit Blick auf die Leistungsgruppen Kooperationen eingegangen werden können. Als ein Beispiel nannte der Minister unter anderem Osnabrück.
Zum heutigen Zeitpunkt sei aber noch nicht klar, welche Leistungsgruppen tatsächlich zum Zuge kommen würden, so Dr. Philippi. Auch zur Aufstellung der Krankenhausversorgung in der Fläche könne noch keine Aussage gemacht werden. Viele Parameter spielten eine Rolle.
Niedersachsen habe sich in dem gesamten Prozess von Anfang an stark positioniert und ihm seine Handschrift aufgedrückt. Es sei wichtig, Ausnahmen zuzulassen, da sei sich der Minister mit seinen Länder-Ministerkollegen einig.
Auch der Transformationsfonds sei ein Thema. Vielfältige Fragen hingen damit zusammen. Auch zum Beispiel, ob bereits im Bau befindliche Häuser unterstützt werden könnten.
An die privaten Krankenhausträger gerichtet, sagte Dr. Philippi: Sie seien unverzichtbare Versorger in Niedersachsen und es sei wichtig, dass auch bei ihnen die Rahmenbedingungen fair seien. Der Minister sagte, er lege Wert auf den ständigen Dialog und rief dazu auf, im Sinne der Patienten gemeinsam an den Aufgaben zu arbeiten. Im Mittelpunkt stünden immer die Menschen.
Helge Engelke, Verbandsdirektor Niedersächsische Krankenhausgesellschaft (NKG), betonte: „Wir haben es in Niedersachsen richtig gemacht, uns frühzeitig mit der Reform zu befassen. Sonst hätten wir nicht so dezidiert an die Bundespolitik herantreten können.“ Unstrittig sei, dass die Ziele des KHVVG eingehalten werden sollen.
Allerdings werde die NKG nicht müde, zu betonen, dass unter anderem die Vorhaltevergütung nicht funktioniere. Sie bleibe 2027 zwar erlösneutral. Aber auch die geplante Verschiebung löse nicht das Problem des völlig falschen Ansatzes.
Engelke zeigte auf, was die NKG insgesamt im Gesetzgebungsprozess erwartet. Dazu gehöre unter anderem die Zurücksetzung der Leistungsgruppen auf das NRW-Modell, eine Anpassung der Standortdefinition und das bereits im Koalitionsvertrag zugesagte Zulassen von Ausnahmeregelungen. Auch seien die Mindestvorhaltezahlen weder evidenzbasiert noch zielführend.
Engelke: „Wir haben zahlreiche Rückfragen aus den Krankenhäusern bekommen und viele gemeinsam mit dem Ministerium geklärt, aber es bleiben viele Fragen, auf die es aktuell keine guten Antworten gibt.“
Dr. Hans-Heinrich Aldag, Vorstandsvorsitzender des Verbandes der Privatkliniken Niedersachsen und Bremen sowie Präsident des Bundesverbands Deutscher Privatkliniken (BDPK), zeichnete die aktuellen Entwicklungen in der Krankenhauspolitik nach und sagte, die neue Gesetzgebung solle die Versorgungsqualität und die Spezialisierung verbessern.
Diese Zielsetzung werde auch von den Privaten sehr geteilt. So seien die hier häufigen Fachkrankenhäuser geradezu Ausdruck dieser Zielsetzung. Allein sehe man viele der dazu bisher im KHVVG festgehaltenen, häufig sehr bürokratischen Mittel beziehungsweise Instrumente wie die Vorhaltefinanzierung, Strukturvorgaben statt Ergebnisqualität und vor allem unzureichende Kooperationsmöglichkeiten grundsätzlich sehr kritisch.
Deshalb habe man durchaus Hoffnung in das derzeit diskutierte Krankenhausreformanpassungsgesetz gesetzt, das allerdings aktuell vor der Kabinettsentscheidung in der schwarz-roten Koalition ins Stocken gekommen zu sein scheine.
Zwar sei bei den privaten Kliniken die Quote der defizitären Häuser geringer als vor allem bei den öffentlichen, allerdings seien sie finanziell und personell zurzeit genauso auf Kante genäht, zumal hier gemeinhin nicht die Chance bestehe, dass einmal entstandene Defizite wie bei öffentlichen Trägern aus Steuermitteln wieder ausgeglichen würden.
Die Beiträge der Veranstaltung machten allesamt deutlich, wie ungewiss die Situation in der Krankenhauslandschaft gerade sei: Es sei schwer zu sagen, wie sich diese in den nächsten Wochen und Monaten entwickele. „Aber wir kämpfen weiter.“
Thomas Bublitz, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Privatkliniken, ging in seinen Ausführungen auf die stark steigenden Gesundheitskosten – insbesondere die Krankenhauskosten – ein. Auffallend dabei sei, dass die Fallkosten im Krankenhausbereich überproportional angestiegen seien, seitdem die Pflegepersonaluntergrenzen und das Pflegebudget eingeführt worden seien. Diese beiden Instrumente verhinderten dringend notwendige Effizienzsteigerungen im Krankenhaus, weshalb man ernsthaft diskutieren müsse, diese wieder abzuschaffen.
Des weiteren betonte Bublitz, dass sowohl die Bundesländer mit einer mangelhaften Investitionskostenfinanzierung als auch der Bund mit einer mangelhaften Betriebskostenfinanzierung für die finanzielle Misere der Krankenhäuser verantwortlich seien. Wettbewerbsverzerrungen entstünden dadurch, dass immer mehr kommunale Träger die Defizite ihrer kommunalen Krankenhäuser aus Steuermitteln ausglichen. Laut einer aktuellen Studie der Unternehmensberatung Curacon beträgt der Verlustausgleich aus Steuermitteln mittlerweile 4 bis 5 Milliarden Euro jährlich. Umgerechnet heiße das, dass jedes kommunale Krankenhausbett mit 20.000 Euro pro Jahr subventioniert werde. An den niedersächsischen Gesundheitsminister Dr. Andreas Philippi gerichtet, appellierte Bublitz, den geplanten Inflationsausgleich an alle Krankenhäuser gleichermaßen auszuschütten. Bedürftige, verschuldete Krankenhäuser auszuwählen, wäre kontraproduktiv und würde unwirtschaftliches Handeln ein weiteres Mal belohnen.
Eike Washausen, AOK Niedersachsen, äußerte sich zuversichtlich, langfristig eine vergleichbare Versorgungsqualität in der Vorsorge- und Rehabilitationslandschaft zu bekommen. Denn mit der sogenannten RE-REHA verfüge der Rehabilitationsbereich nun über eine strukturierte Basis: Es werde Transparenz geschaffen und Standards würden vereinheitlicht. Die Chancen lägen insbesondere in klareren Qualitätsstandards und einer transparenteren Vergleichbarkeit. Demgegenüber stünden Herausforderungen durch komplexere Abstimmungsprozesse sowie den Spagat zwischen Personalvorgaben und Fachkräftemangel. Eike Washausen gab sich aber optimistisch und riet mit Blick auf die Rahmenempfehlung Vorsorge und Rehabilitation gemeinsam im Sinne eines lernenden Systems an diese heranzutreten.
Bei Auslegungsfragen gelte es, gemeinsame Lösungen finden.
Nina Boes, Leitung der Abteilung für Rehabilitation bei der Deutschen Rentenversicherung Westfalen, betonte hinsichtlich aktueller Entwicklungen – zum Beispiel auch zum Thema Zulassungen: „Wir können es uns nicht erlauben, auch nur eine Einrichtung vom Markt verschwinden zu lassen.“ Sie sagte: „Wenn wir – wie im Koalitionsvertrag vorgesehen – den Grundsatz Prävention vor Rehabilitation vor Rente weiter stärken und den Ü45-Check bundesweit ausrollen, braucht es auch weiterhin qualitativ hochwertige Einrichtungen, die uns bei der Erfüllung unseres gesetzlichen Auftrages als verlässliche Partner zur Seite stehen.“ Auch blickte Nina Boes auf das ab dem 1. Januar 2026 geltende neue Vergütungssystem, bestehend aus einer einrichtungsübergreifenden und einer einrichtungsspezifischen Komponente: Die Summe beider Komponenten ergebe den Vergütungssatz. Auch hier seien Fragen offen. Letztlich solle man sich aber immer darauf besinnen, was auch der Minister unterstrichen habe: „Wir sind für den Menschen da. Wir müssen unseren Auftrag am Menschen viel stärker gemeinsam durchsetzen, weil wir dann viel mehr Kraft aufbringen.“ Nina Boes unterstrich noch einmal, „dass dies nur gelingen kann, wenn sich Kostenträger und Leistungserbringer gemeinsam für eine auskömmliche finanzielle Ausstattung stark machen“.

Gebündelt, stets aktuell und immer handverlesen werden alle Neuigkeiten gesammelt und anwenderbezogen aufbereitet.