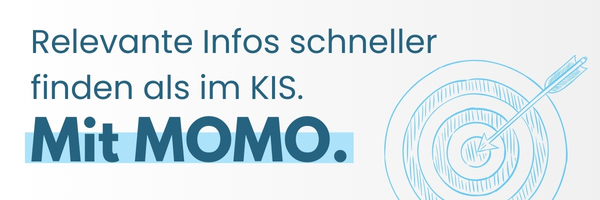Medizinische Begründung (MBEG) sichert prüfsichere Krankenhausabrechnung
Medizinische Begründung
- MD

Die (MBEG) ist längst mehr als ein Verwaltungsakt. Sie entscheidet maßgeblich darüber, wann eine Krankenhausrechnung fällig wird, ob eine ambulant zu erbringende Leistung doch stationär vergütet werden darf und ob der Medizinische Dienst (MD) im Vorverfahren mit den Kostenträgern Einsparpotenziale erkennt. Für Medizincontroller, Klinikärzte, Kodierfachkräfte sowie Krankenhausmanager steht damit ein Schlüsselinstrument im Mittelpunkt, das rechtlich präzise, klinisch schlüssig und formell korrekt ausgeführt sein muss.
Begriff und Abgrenzung einer MBEG
Die MBEG ist die fall- und patientenbezogene Darlegung, warum eine Behandlung – insbesondere ihre Dauer oder ihre stationäre Durchführung – medizinisch zwingend erforderlich war. Ihr gesetzlicher Kern findet sich in § 301 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 SGB V. Erst wenn die gemeldete voraussichtliche Verweildauer überschritten wurde und die Kasse eine Begründung anfordert, entsteht eine Pflicht zur Übermittlung. Gleichwohl hat die sozialgerichtliche Rechtsprechung den Anwendungsbereich ausgeweitet: Liegt eine Leistung vor, die laut AOP-Katalog regelhaft ambulant erbracht wird, muss das Krankenhaus ohne ausdrückliche Anforderung eine MBEG liefern [Link: Bregenhorn-Wendland & Partner Rechtsanwälte mbB].
Rechtliche Leitplanken der MBEG
Datenträgeraustausch (§ 301 SGB V). Anlage 5 der Vereinbarung regelt Struktur, Fristen und obligatorische Textsegmente. Besondere Aufmerksamkeit gilt den Passagen zur Übermittlung bei Kontextfaktoren und bei § 8 Abs. 3 AOP-Vertrag, wo soziale oder individuelle Gründe ein stationäres Setting rechtfertigen.
AOP-Vertrag (§ 115b SGB V). Seit 2025 ordnet Anlage 1 mehr Leistungen eindeutig dem ambulanten Sektor zu. Kontextfaktoren dienen als „Brücke“ zur stationären Abrechnung; fehlt ein passender Kontext, muss das Krankenhaus die stationäre Notwendigkeit fallindividuell in einer MBEG begründen.
Sozialgerichtliche MBEG Entscheidungen
| Jahr | Gericht / Az. | Kernaussage |
| 2023 | BSG B 1 KR 11/22 R | Kein Anspruch auf Aufwandspauschale, wenn das Krankenhaus die MBEG trotz Anforderung nicht liefert und damit das Prüfverfahren veranlasst. |
| 2024 | SG München S 18 KR 140/24 | Aufwandspauschale kann zugesprochen werden, wenn die Kasse nach Erörterungsverfahren die Abrechnung bestätigt; MBEG war hier formal korrekt. |
| 2025 | SG Stuttgart S 18 KR 59/24 | Die medizinische Begründung (MBEG) muss keine detaillierte Verteidigung der stationären Aufnahme liefern. Ein kurzer, fallbezogener Hinweis auf besondere Risiken ist ausreichend. |
Diese Entscheidungen festigen eine doppelte Pflicht: formale Vollständigkeit der Begründung und inhaltliche Plausibilität im Lichte des AOP-Katalogs.
MBEG-Praxisleitfaden für Medizincontroller und Klinikärzte
- Frühzeitige Weichenstellung. Prüfen Sie bei Aufnahme, ob eine Leistung im aktuellen AOP-Katalog gelistet ist und ob ein Kontextfaktor greift. Fehlen diese, dokumentieren Sie medizinische oder soziale Gründe lückenlos im Arztbrief und im § 301-MBEG-Textsegment.
- Klarer Aufbau. Formulieren Sie die MBEG in drei Schritten: medizinische Ausgangslage (Diagnose, Komorbidität), Behandlungsrisiko bei ambulanter Versorgung, Nutzen der stationären Therapie. Halten Sie sich an Fließtext ohne Abkürzungsdichte.
- Fristen managen. Spätestens mit Überschreitung der prognostizierten Verweildauer oder mit Schlussrechnung muss die Begründung elektronisch übermittelt werden (§ 301, Anlage 5). Verspätungen gelten als formaler Fehler und öffnen die Tür für Rechnungskürzungen.
- Teamarbeit stärken. Binden Sie Ärzte, Pflege- und Kodierfachkräfte ein. Nur wer klinische Details kennt, kann eine prüffeste Narration schreiben. Schulungen zu Kontextfaktoren senken Fallrisiken.
Erwartungen des Medizinischen Dienstes
Der MD beurteilt MBEG in drei Prüfdimensionen:
- Relevanz. Beschreibt die Begründung eine fallbezogene Gefährdung des Behandlungserfolgs oder erhebliche Risiken bei ambulanter Durchführung?
- Konkretion. Allgemeinplätze wie „multimorbider Patient“ genügen nicht. Erwartet wird eine patienten- und eingriffsbezogene Risikodarstellung mit Bezug zu Leitlinien oder Vitalparametern.
- Nachvollziehbarkeit. Die Angabe muss sich in Akten, Vitaldaten und Pflegeberichten wiederfinden lassen. Fehlende Korrelation zwischen MBEG-Text und Krankenakte führt häufig zu Gutachtenabweichungen.
MD-Gutachten 2024 zeigen, dass etwa 35 % der beanstandeten Rechnungen allein wegen unzureichender MBEG gekürzt wurden. Häufigster Fehler: Übernommene Standardphrasen ohne individuelle Risikoabwägung.
Fazit und strategische Hinweise
Die Medizinische Begründung hat sich von der oft belächelten „Kurzbegründung“ zum entscheidenden Compliance-Dokument entwickelt. Wer sie als integrierten Teil des klinischen Workflows versteht, minimiert MD-Risiken, verkürzt Durchlaufzeiten der Rechnungsbearbeitung und wahrt Liquidität. Investitionen in Schulungen, klar definierte Prozesspfade und Echtzeit-Verweildauer-Monitoring zahlen sich aus – nicht nur finanziell, sondern auch im Sinne einer transparenten Patientenversorgung.
Lesen Sie auch
„Das Sozialgericht Stuttgart stärkt die Kliniken – eine schlanke MBEG-Bearbeitung reicht aus“
FAQ: Medizinische Begründung (MBEG) & prüfsichere Krankenhausabrechnung
Die MBEG ist eine fall- und patientenbezogene Darlegung, warum eine stationäre Behandlung beziehungsweise deren Dauer medizinisch zwingend erforderlich war.
Sobald die prognostizierte Verweildauer überschritten ist oder wenn eine laut AOP-Katalog typischerweise ambulante Leistung stationär durchgeführt wird.
Die Kernnorm ist § 301 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 SGB V in Verbindung mit Anlage 5 der Datenträgeraustausch-Vereinbarung. Ergänzend regelt § 115b SGB V (AOP-Vertrag) die Abgrenzung zwischen ambulanter und stationärer Versorgung.
Er ordnet OPS-Leistungen eindeutig dem ambulanten Sektor zu. Fehlt ein Kontextfaktor, muss das Krankenhaus die stationäre Behandlungsnotwendigkeit individuell über eine MBEG begründen.
Elektronische Übermittlung im § 301-Datensatz, fristgerechte Abgabe, strukturierte Textsegmente und verständlicher Fließtext ohne Abkürzungsdichte.
(1) Medizinische Ausgangslage – Diagnosen und Komorbiditäten
(2) Risiken einer ambulanten Versorgung
(3) Nutzen der stationären Therapie, jeweils patienten- und eingriffsbezogen.
Goldstandard: Ärzte der Indikationssprechstunden arbeiten dabei mit dem Medizincontrolling und den Kodierfachkräften zusammen.
Krankenkassen können betroffene Rechnungen abweisen. Beanstandet der Medizinische Dienst die Leistung bei fehlender MBEG, geht die Aufwandspauschale verloren (vgl. BSG B 1 KR 11/22 R).
Nach den Kriterien Relevanz, Konkretion und Nachvollziehbarkeit – jede Aussage muss sich in Akten, Vitaldaten und Pflegeberichten nachweisen lassen.
Standardphrasen ohne individuelle Risikoanalyse, verspätete Übermittlung, fehlender Bezug zu Leitlinien oder Kontextfaktoren.
Etwa SG Stuttgart S 18 KR 59/24 („kurzer, fallbezogener Hinweis genügt“) und SG Düsseldorf S 15 KR 134/24 (Begründungspflicht auch ohne ausdrückliche Kassenanforderung).
Frühzeitige AOP-Prüfung bei Aufnahme, Standard-Templates, interdisziplinäre Schulungen sowie Echtzeit-Monitoring der Verweildauer.
Spätestens mit Schlussrechnung oder unmittelbar nach Aufforderung durch die Kasse; bei AOP-Leistungen ohne Kontextfaktor ist eine proaktive MBEG erforderlich.
Ja – wenn individuelle medizinische, soziale oder organisatorische Risiken überzeugend dargelegt sind.
Autor: Michael Thieme, Ärzt. Leiter Medizincontrolling BKJL, Inhaber medinfoweb.de
Mannheim, den 16.07.2025
medinfoweb.de

Gebündelt, stets aktuell und immer handverlesen werden alle Neuigkeiten gesammelt und anwenderbezogen aufbereitet.