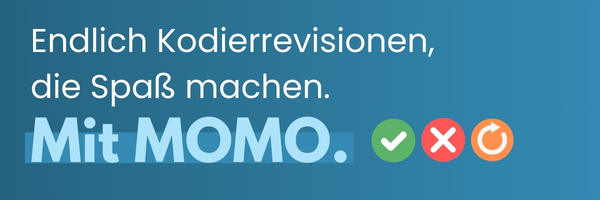Präzise Bedarfsplanung in der Gesundheitsversorgung: Herausforderungen und Lösungen
Prof. Andreas Schmid von der Oberender AG erklärt im Interview, warum planerische Entscheidungen im Gesundheitswesen eine besondere Herausforderung darstellen und welche Faktoren dabei berücksichtigt werden müssen.
- Ökonomie
Franka Struve-Waasner
In der freien Marktwirtschaft regeln Angebot und Nachfrage den Markt weitgehend selbst. Doch wie sieht es im Gesundheitswesen aus, wo das Angebot nicht automatisch durch diese Mechanismen gesteuert wird? Prof. Andreas Schmid von der Oberender AG erklärt im Interview, warum planerische Entscheidungen im Gesundheitswesen eine besondere Herausforderung darstellen und welche Faktoren dabei berücksichtigt werden müssen.
Franka Struve-Waasner: Die Bedarfsplanung ist besonders wichtig, da sie planerisch statt durch Angebot und Nachfrage gesteuert wird. Stimmt das?
Prof. Andreas Schmid: Ja. Sie müssen die reale Nachfrage treffen. Planungen müssen das ausgleichen, was sich in anderen Wirtschaftsbereichen von selbst regelt, und dabei zum Teil weit in die Zukunft reichende Strukturentscheidungen treffen.
FS: Es gibt verschiedene Ansätze zur medizinischen Bedarfsplanung in Deutschland. Einerseits liefert der Versorgungsatlas des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (Zi) Informationen zur regionalen medizinischen Versorgung. Andererseits existiert die Krankenhausplanung der Gesundheitsministerien der Bundesländer. Wie laufen diese Ansätze zusammen?
AS: Der Begriff „Bedarf“ ist schwer operationalisierbar und hat zugleich eine fundamentale Bedeutung für jegliche Planung. Um mich ihm anzunähern, benötige ich Daten. Abrechnungsdaten sind am leichtesten verfügbar. Sie reflektieren aber eine Versorgungssituation im Status quo. Das heißt, wenn ich in einer Region insuffiziente Versorgungsstrukturen habe und eine Unterversorgung vorliegt, dann schlägt sich der in der Region vorhandene Bedarf nicht in diesen Zahlen nieder. Es gibt wenige Erhebungen, die tatsächliche Bedarfe über Befragungen ermitteln, wie beispielsweise Surveys vom RKI.
Wir unterteilen die Bedarfsplanung in zwei Hauptschritte:
Erfassen des Bedarfs: Die Schwierigkeit liegt darin, den tatsächlichen Bedarf zu erfassen, da vorhandene Daten oft unzureichend sind.
Adäquate Versorgungsstrukturen: Hier gilt es zu klären, wie das Angebot auf verschiedene Standorte der Leistungserbringung verteilt werden.
Früher waren die Strukturen zwischen ambulant und stationär klarer getrennt, heute gibt es zunehmend hybride Strukturen und sich ändernde Krankheitsbilder sowie therapeutische Optionen, die eine frühere stationäre Behandlung heute ambulant ermöglichen. Es gibt oft verschiedene Optionen und keine objektiv richtige Antwort.
FS: Welcher Bedarf besteht für ältere Menschen, die für einen stationären Aufenthalt geeignet sind, aber keine Operationen benötigen und nicht für Reha oder Pflegeheime geeignet sind?
AS: Diese Patienten fallen oft durch das Raster der aktuellen Versorgungsstrukturen. Wir haben Krankenhausdaten analysiert und Gespräche mit Ärzten geführt. Es gibt eine relevante Zahl an Patienten, die ambulant nicht sicher geführt werden können. Sie wären zu Hause überfordert, das heißt, der Arzt kann die Patienten nicht guten Gewissens ins häusliche Umfeld zurückschicken, aufgrund einer gewissen medizinischen Indikation, die durch soziale Rahmenbedingungen – wie Alter und alleinstehend – ergänzt wird. Sie benötigen eine qualifizierte pflegerische Beobachtung, aber keine Intensivstation oder 24/7-ärztliche Präsenz.
Das Institut für Allgemeinmedizin der Universität Tübingen hat bestätigt, dass eine minimalistische Versorgungsstruktur, wie ein intersektorales Gesundheitszentrum, oder Level 1i-Haus diese Patienten sicher und qualitativ hochwertig versorgen kann.
FS: Wie berücksichtigen Sie die Zunahme chronischer Erkrankungen?
AS: Die demografische Entwicklung erklärt einen Großteil der Nachfrage nach Gesundheitsleistungen, weil (chronische) Erkrankungen meist im Alter auftreten. Veränderungen in der Medizin, wie die Ambulantisierung, und das sich verändernde Krankheitsspektrum sind ebenfalls relevant. Zum Beispiel steigt der Bedarf an Ablationen im Herzkatheter (Anm. der Red. ‘Ablation‘ ist das Veröden von Körpergewebe, z.B. bei Vorhofflimmern), aber für rein diagnostische Herzkatheter werden weniger Kapazitäten benötig. In der Onkologie leben Patienten länger mit ihrer Krankheit, viele Chemotherapien werden ambulant durchgeführt. Es kommt immer auf das Indikationsgebiet an und welche Faktoren die Entwicklung primär treiben.
FS: Wie beeinflussen technologische Fortschritte und Innovationen im Gesundheitswesen Ihre Berechnungen für den zukünftigen Bedarf an medizinischen Leistungen?
AS: Wir prüfen das im Detail. Wenn Sie jetzt beispielsweise sagen, Sie benötigen ein Medizinkonzept für ein Krankenhaus, betrachten wir zuerst die vorhandenen Indikationsbereiche und die demografische Entwicklung in der Region. Dann sprechen wir mit Fachbereichsverantwortlichen und Experten, um zu validieren, welche technologischen Entwicklungen und Innovationen in diesem konkreten Fall zu berücksichtigen sind.
FS: Welche Rolle spielt die regionale Verteilung der Bevölkerung bei der Planung der medizinischen Versorgungskapazitäten?
AS: Sie spielt eine große Rolle. Historisch gewachsene Krankenhausstrukturen führen zu einer ungleichen Verteilung: In einigen Regionen gibt es eine hohe Krankenhausdichte, während in anderen die Bevölkerung weite Wege zu Schwerpunkt-Versorgern zurücklegen muss.
FS: Die relevanten Faktoren sind also die Anzahl der Krankenhäuser pro Kopf und deren Erreichbarkeit innerhalb von 30 Minuten?
AS: Erreichbarkeit ist wichtig, aber es gibt keine objektiv hergeleitete Größe. In Deutschland ist uns wichtig, dass gewisse Zeitfenster, wie die „Golden Hour“ bei Herzinfarkt oder Schlaganfall, eingehalten werden. Notfälle erfordern zeitnahe Intervention. Bodengebundene Rettungsmittel haben Limitationen, während Rettungshubschrauber größere Strecken abdecken können. Bei elektiven Eingriffen sind längere Wegstrecken akzeptabel, insbesondere bei spezialisierten Zentren.
FS: Welche spezifischen Herausforderungen sehen Sie bei der Bedarfsplanung für ländliche versus städtische Gebiete?
AS: In ländlichen Regionen führt der Fachkräftemangel dazu, dass oft nicht ausreichend Personal für die benötigten Versorgungsstrukturen vorhanden ist. Dies erfordert eine Abwägung zwischen Wunschvorstellungen und realisierbaren Strukturen. Historisch gewachsene Krankenhausstrukturen entsprechen oft nicht dem heutigen Bedarf, was die Planung erschwert. Und hier gibt es einerseits große rechtliche Hürden, existierende Krankenhäuser gegen den Willen der Träger zu schließen, und andererseits in manchen Bundesländern auch eine ganz grundsätzliche Zurückhaltung aktiv in die Krankenhausplanung dahingehend einzugreifen, dass Standorte wirklich zur Disposition gestellt werden. Einige Bundesländer, wie Baden-Württemberg, gehen proaktiv vor und bauen Standorte zurück, um zentralisierte Neubauten zu schaffen.
FS: Welche Rolle spielt Patientenpräferenz in Ihren Modellen zur Bedarfsermittlung?
AS: Patientenpräferenzen sind wichtig. Wir betrachten sowohl geografische Reichweite als auch reale Einzugsgebiete. Oft stellen wir fest, dass die Bevölkerung zwar in Reichweite ist, aber trotzdem andere Einrichtungen bevorzugt – besonders bei kleinen Krankenhäusern. In solchen Fällen analysieren wir, wie wir das ändern können. Möglicherweise müssen wir die Qualität verbessern oder die externe Kommunikation anpassen. Das Vorgehen ist immer fallabhängig.
FS: Wie berücksichtigen Sie die finanzielle Nachhaltigkeit der Krankenhausbetreiber in Ihren Bedarfsberechnungen?
AS: Der Bedarf ist unabhängig von der Wirtschaftlichkeit des Krankenhauses. Es geht darum, welche Versorgungsstruktur den Bedarf decken kann und wirtschaftlich tragfähig ist. Aktuell arbeite ich an einem Projekt, das drei unrentable Standorte zu einem zentralen, wirtschaftlich überlebensfähigen Standort zusammenführt, um den regionalen Versorgungsbedarf zu decken.
Danke für das Gespräch!
Prof. Dr. Andreas Schmid ist Manager bei der Oberender AG und Experte für Gesundheitsökonomie und Gesundheitsmanagement. Er studierte Gesundheitsökonomie an der Universität Bayreuth und der University of North Carolina in Chapel Hill, USA, und promovierte bei Prof. Dr. Volker Ulrich. Von 2013 bis 2019 war er Juniorprofessor für Gesundheitsmanagement an der Universität Bayreuth. Seine Schwerpunkte sind die Analyse und Entwicklung von Versorgungsstrukturen und Vergütungsmodellen sowie deren Reformen. In diesem Kontext erstellte er ein Gutachten zu Intersektoralen Gesundheitszentren für die Kassenärztliche Bundesvereinigung.
Die Autorin, Diplom-Kauffrau Franka Struve-Waasner, arbeitete knapp sechs Jahre sie als Pressesprecherin des Klinikums Forchheim-Fränkische Schweiz. Nach einer Station als Referentin Kommunikation beim Klinikum Neumarkt schreibt sie heute u.a. freiberuflich zu Themen ‚rund ums Krankenhaus‘.
Franka Struve-Waasner