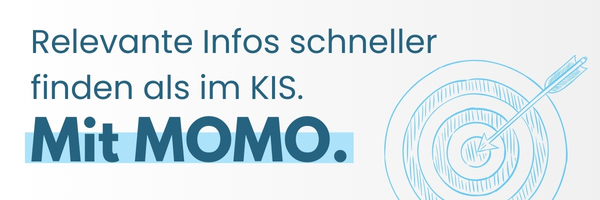Ambulantisierung 2025: Hybrid DRG, AOP & Chancen für Kliniken
Die Ambulantisierung ist ein zentrales gesundheitspolitisches Ziel der Krankenhausreform 2025.
Inhalt des Artikels
- Politik
- QM
Ärzt. Leiter Medizincontrolling BKJL, Inhaber medinfoweb.de
Ambulantisierung als Ziel der Krankenhausreform 2025
Die Ambulantisierung ist ein zentrales gesundheitspolitisches Ziel der Krankenhausreform. Sie soll planbare Eingriffe und Behandlungen aus der stationären Versorgung in den ambulanten Bereich verlagern. Damit werden Krankenhauskapazitäten für komplexe Fälle freigehalten. Zugleich sollen Patientinnen und Patienten wohnortnah, zeitnah und kosteneffizient versorgt werden. Der Ansatz verbindet Versorgungsqualität mit wirtschaftlicher Steuerung und schafft neue Strukturen für eine bedarfsgerechte Versorgung.
Begriffsrahmen und Versorgungsformen
Ambulante Eingriffe im Krankenhaus stützen sich derzeit im Wesentlichen auf zwei gezielte Steuerungsinstrumente: Erstens das ambulante Operieren nach §115b SGB V auf Grundlage des AOP-Vertrags und des zugehörigen Katalogs. Zweitens die sektorengleiche Vergütung über Hybrid-DRG nach §115f SGB V, die bislang nur für ausgewählte Leistungen gilt, perspektivisch aber ausgeweitet werden soll.
Darüber hinaus erbringen Krankenhäuser ambulante Notfallbehandlungen, die nach EBM vergütet werden. Diese stellen jedoch keinen planvoll gesteuerten Baustein der Ambulantisierung dar, sondern sichern die Akutversorgung im Rahmen der Bedarfsplanung. Während AOP und Hybrid-DRG einen strukturierten Wandel in Richtung Ambulantisierung fördern, bleibt die Notfallambulanz ein eigenständiger Versorgungsbereich.
Rechtsrahmen und Vergütung
§115b SGB V verpflichtet die Partner der Selbstverwaltung zum AOP-Vertrag und zum Katalog ambulant durchführbarer Eingriffe. Krankenhäuser rechnen AOP-Fälle direkt mit den Krankenkassen ab; Grundlage ist der §301-Datenaustausch, u. a. mit dem „Rechnungssatz Ambulante Operation“. Im AOP-Katalog werden jährlich neu die angepassten OPS-Kodes auf aktuell gültige Version übergeleitet. Außerdem erfolgt durch die Vertragspartner eine inhaltliche Anpassung an EBM-Vorgaben an. Der AOP-Katalog 2025 trat am 1. Januar 2025 in Kraft.
Hybrid-DRG wurden durch BMG-Verordnung zum 01.01.2024 eingeführt und zum Vereinbarungsjahr 2025 in eine Vergütungsvereinbarung der KBV, DKG und GKV-SV überführt. Für 2025 wurden Katalog und Berechnungssystematik fortgeschrieben und erweitert. Auch die Hybrid-DRG jährlich neu durch das InEK kalkuliert. Grundlage ist Hybrid-DRG-Vergütungsvereinbarung der Selbstverwaltung. Die „Vereinbarung zu der speziellen sektorengleichen Vergütung (HybridDRG) gemäß § 115f SGB V für das Jahr 2025“ trat am 18.12.2024 in Kraft (InEK)
Die ambulante Notfallbehandlung im Krankenhaus wird nach §120 SGB V als vertragsärztliche Leistung vergütet und folgt dem EBM. Ein Urteil des Bundessozialgerichts vom 06.03.2024 präzisiert den Investitionskostenabschlag auf EBM-Einzelleistungen.
Die tagesstationäre Behandlung nach §115e SGB V wird mit Entgelten des KHEntgG abgerechnet; ergänzende Dokumentations- und Abrechnungsvereinbarungen der Selbstverwaltung konkretisieren Verfahren und Prüfkriterien, z. B. zur Notwendigkeit von Übernachtungen. Eingeführt durch das Krankenhauspflegeentlastungsgesetz (KHPflEG, Ende 2022). Start war ursprünglich zum 1. Januar 2023 vorgesehen, Umsetzung verzögert sich aber bis heute (2025) durch fehlende Detailvereinbarungen. Praktisch wurde das Gesetz bis heute nicht umgesetzt. Es fehlen konsentierten Kataloge und eine flächendeckende Vergütungssystematik. Krankenkassen und Krankenhäuser konnten sich nicht auf Fallgruppen und Entgelte einigen. Der §115e ist zwar Gesetz, wird aber bislang nicht mit Leben gefüllt.
Gesundheitspolitische Ziele und Steuerungswirkung
Ambulantisierung soll Kapazitäten im stationären Bereich entlasten, Wartezeiten verkürzen und die Patientenzufriedenheit erhöhen. Hybrid-DRG beseitigen Sektorengrenzen für ausgewählte Leistungen durch eine einheitliche Fallpauschale. Die 2025er-Vereinbarungen der Selbstverwaltung führen den Start von 2024 fort, stabilisieren Abläufe und erweitern den Katalog. Die AOP-Überleitung auf OPS 2025 schafft technische Klarheit für Kodierung und IT-Prozesse.
IIm Rahmen der Diskussion zur Krankenhausreform hat Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) das Ziel bekräftigt, bis 2030 mindestens zwei Millionen bislang vollstationär behandelte Fälle über die Hybrid-DRG zu steuern. Hintergrund ist, dass Deutschland im internationalen Vergleich noch zu viele Leistungen stationär erbringt. Mit der Hybrid-DRG sollen diese Ambulantisierungspotenziale vollumfänglich genutzt werden. Krankenkassen, Kliniken und Kassenärztliche Bundesvereinigung mahnen jedoch Tempo, Strukturen und Kostenfolgen kritisch an.
Leistungsabgrenzung und Betriebsmodelle
Die Abgrenzung erfolgt zweifach: intern gegenüber der stationären DRG-Versorgung und extern gegenüber der vertragsärztlichen Versorgung. Der Zentral-OP bündelt komplexe, interdisziplinäre sowie notfallbedingte Eingriffe mit potenziell stationärem Verlauf. Das Ambulante Operationszentrum (AOZ) verantwortet planbare, standardisierte Eingriffe nach § 115b SGB V (AOP-Vertrag) mit klar definiertem Pfaden für die Indikation, Einbestellung, Durchführung und Entlassung der Patienten.
Organisationspraktisch bedeutet dies: Der Zentral-OP und der Ambulante OP-Bereich (AOZ) sind komplementäre Leistungsbereiche mit eigenen Prozessen, Ressourcen und Steuerungslogiken. Schnittstellen, Indikationskriterien und Patientenpfade müssen eindeutig definiert werden.
Umsetzung von der Indikation bis zur Abrechnung
Indikation
Ärztinnen und Ärzte definieren pro Eingriff klare Ein- und Ausschlusskriterien. ASA-Klasse, Komorbiditäten, soziales Umfeld und Transportfähigkeit sind zu prüfen. Ziel ist eine belastbare Ambulant-oder-Stationär-Entscheidung mit dokumentierten Entlasskriterien und Nachsorgeregelungen. AWMF/DGAI empfehlen die Einbindung strukturierter Scorings und ein 24-Stunden-Kontaktangebot.
Aufnahme
Aufnahme und die präoperative Vorbereitung erfolgen standardisiert. Die Voranamnese wird digital erhoben, ein strukturierter Medikationsabgleich ist verpflichtend. Die Diagnostik richtet sich konsequent nach der Indikation. Aufklärungen werden rechtzeitig durchgeführt und vollständig dokumentiert; Checklisten sind verbindlich anzuwenden. Die Schnittstellen zum AOZ sind medienbruchfrei gestaltet.
OP-Management
In ambulanten OP-Zentren stehen planbare Eingriffe und eine hohe Taktung im Vordergrund. Anders als in Akutkrankenhäusern entfällt die Notfallversorgung, was eine präzise Steuerung der Abläufe ermöglicht. Damit der OP-Tag reibungslos funktioniert, ist eine strukturierte Blockplanung entscheidend.
Die Zuordnung der Eingriffe zu festen Blöcken orientiert sich an der durchschnittlichen Operationsdauer. Kurze, standardisierte Prozeduren lassen sich so sequenziell bündeln, längere Eingriffe werden gezielt in eigene Slots eingeplant. Diese Struktur verhindert Verzögerungen im Tagesablauf und sorgt für eine gleichmäßige Auslastung.
Ein pünktlicher Beginn ist der Taktgeber für den gesamten OP-Tag. Schon kleine Abweichungen am Morgen wirken wie ein Dominoeffekt und verschieben alle nachfolgenden Termine. Die Startzeit-Treue gilt deshalb als zentrale Kennzahl für die Leistungsfähigkeit eines AOZ.
Zwischen zwei Eingriffen sind definierte Wechselzeiten erforderlich. Diese Puffer berücksichtigen sowohl das Aufräumen und Aufrüsten des Saals als auch die Patientenvorbereitung. Ein realistisches Zeitfenster verhindert Engpässe und sichert die Einhaltung der Tagesplanung, ohne dass unnötige Leerlaufzeiten entstehen.
Anästhesiemanagement
Im ambulanten OP-Zentrum erfolgt die Prämedikation gezielt und zurückhaltend. Im Vordergrund steht die anxiolytische Medikation, meist in niedriger Dosierung mit Midazolam, während eine überflüssige Sedierung vermieden wird. Grundlage bildet eine strukturierte präoperative Checkliste, die ASA-Status, Allergien, Dauermedikation und Nüchternheit zuverlässig erfasst.
Für kurze Eingriffe ist die Totalintravenöse Anästhesie (TIVA) mit Propofol und Remifentanil Standard, da sie eine schnelle Erholung ermöglicht. Regionalanästhesieverfahren wie Spinal- oder Leitungsblockaden eignen sich besonders für klar definierte Eingriffe mit dem Vorteil einer guten postoperativen Analgesie und reduzierter PONV-Rate. Bei sehr kurzen, risikoarmen Eingriffen kommt die Analgo-Sedierung in Kombination mit lokaler Infiltration zur Anwendung.
Im Aufwachraum wird ein engmaschiges Standardmonitoring mit EKG, SpO₂ und Blutdruck durchgeführt, bei Bedarf ergänzt um eine Atemwegskontrolle. Schmerzen und Übelkeit werden systematisch erfasst, beispielsweise mit NRS oder PONV-Score, und in festen Zeitintervallen dokumentiert.
Entlassung und Nachsorge
Die Entlassung erfolgt nach klar definierten Kriterien: stabile Kreislaufparameter, erhaltene Schutzreflexe, suffiziente Schmerz- und Übelkeitskontrolle, sichere Mobilisation sowie tolerierte Flüssigkeitsaufnahme. Zur Objektivierung dienen validierte Scores wie der Aldrete-Score (≥ 9–10) oder der PADSS (≥ 9). Zudem muss eine Begleitperson vorhanden sein und ein sicherer Heimtransport gewährleistet werden.
Vor der Entlassung erhalten die Patienten eine mündliche und schriftliche Aufklärung über Medikation, mögliche Warnzeichen und eine jederzeit erreichbare Notfallnummer. Ein geplanter Kontrolltermin oder die Rückmeldung an die Haus- bzw. Fachärztin stellt die weitere Nachsorge sicher.

Dokumentation und Kodierung
Im Ambulanten OP-Zentrum ist eine lückenlose und standardisierte Dokumentation unverzichtbar: Der OP-Bericht bildet den zentralen Nachweis des Eingriffs, ergänzt um prä- und postoperative Befunde. Für die Abrechnung werden die erbrachten Leistungen über OPS- und ICD-Kodierung im Krankenhausinformationssystem verschlüsselt, sodass eine saubere Zuordnung zu §301-Meldungen möglich ist. Bei ambulanten Notfällen erfolgt die Dokumentation zusätzlich nach den Vorgaben der Kassenärztlichen Vereinigung im EBM-System, um eine korrekte KV-Abrechnung sicherzustellen. Einheitliche Vorlagen, zeitnahe Erfassung und regelmäßige Plausibilitätsprüfungen garantieren Prozesssicherheit und minimieren Retaxationsrisiken.
Abrechnung ambulanter OP-Leistungen
Im Ambulanten OP-Zentrum erfolgt die Abrechnung differenziert nach Versorgungsform: Ambulante Operationen werden auf Basis des AOP-Vertrags nach §115b SGB V abgerechnet, die Datenübermittlung läuft über den §301-Datentransfer mit dem „Rechnungssatz Ambulante Operation“. Für Leistungen aus dem Hybrid-DRG-Katalog gilt seit 2025 die Hybrid-DRG-Vergütungsvereinbarung mit fortgeschriebenem Berechnungsschema. Ambulante Notfallbehandlungen werden nach §120 SGB V über die Kassenärztliche Vereinigung im EBM-System abgerechnet. Hierbei ist der Investitionskostenabschlag entsprechend der geltenden Rechtsprechung zu berücksichtigen.
AOZ-Controlling
Im Controlling eines großen Ambulanten OP-Zentrums steht die konsequente Steuerung von Fallauswahl und -zahlen im Vordergrund. Dabei werden sektorübergreifend die Volumina beobachtet und Erlöse aus AOP-Leistungen mit Hybrid-DRGs verglichen, während Grenzfälle systematisch auf tagesstationäre Behandlungsnotwendigkeit geprüft werden.
Wöchentliche OP-KPI-Reports – etwa zu Startzeit-Treue, Wechselzeiten, Nutzungsgrad, Abbruch- und Stornoraten – liefern die Basis, um Abweichungen nicht reaktiv, sondern prozessual zu adressieren. Ein verbindliches Glossar klar definierter Zeitpunkte stellt valide Messungen sicher und verhindert Interpretationsfehler. Zeitnahe, konsistente Berichte schaffen Transparenz im Team, ermöglichen Benchmarking und sichern die kontinuierliche Optimierung der Abläufe.
Krankenhausmanagement
Das Krankenhausmanagement eines erfolgreichen Ambulanten OP-Zentrums (AOZ) trägt die Gesamtverantwortung für eine klare Governance und die strategische Ausrichtung. Es stellt sicher, dass alle Mitarbeitenden über die erforderliche Qualifikation verfügen und kontinuierlich fortgebildet werden. Zentrale Aufgabe ist die saubere Trennung der Patientenströme gegenüber dem stationären Bereich, um Effizienz und Sicherheit zu gewährleisten. Darüber hinaus pflegt das Management verlässliche Kooperationen mit Vertragsärztinnen und -ärzten, die als Partner für eine stabile Auslastung und ein breites Leistungsspektrum unerlässlich sind. Ebenso gehören der Aufbau und die Steuerung digitaler Prozesse in IT, Dokumentation, Abrechnung und Controlling zu den Kernaufgaben, ergänzt durch die Erstellung und laufende Anpassung des spezifischen Wirtschaftsplans für das AOZ.
Chancen und Risiken im Überblick
Pro. Entlastung der Betten und des Zentral-OP, kürzere Aufenthalte, höhere Zufriedenheit, effiziente Nutzung von Fachkräften. Hybrid-DRG stärken das „gleiche Preis für gleiche Leistung“-Prinzip. AOP-Überleitung 2025 erhöht Kodierklarheit.
Contra. Abgrenzung zur eigenen stationären Versorgung und zur vertragsärztlichen Ebene bleibt anspruchsvoll. Fehler in Indikation, Dokumentation oder Routing führen zu Retaxationen. Die 2025er-Regelungen erfordern Prozess- und IT-Updates.
Fazit und Ausblick
Ambulante Eingriffe im Krankenhaus sind eine echte Chance. Sie gelingen, wenn der Rechtsrahmen präzise umgesetzt wird, AOZ und Zentral-OP taktisch sauber getrennt sind und Indikation, Recovery und Abrechnung wie Zahnräder ineinandergreifen. Ambulantisierung ist kein Sprint, sondern ein Taktwechsel. Wer den Takt vorgibt, senkt Komplexität und erhöht Qualität.
Der Bundesverband Medizintechnologie (BVMed) fordert im aktuellen Positionspapier zur Krankenhausreform gezielte Anpassungen im Krankenhausreformanpassungsgesetz (KHAG) zur Einführung der Hybrid-DRGs. Der Verband betont, dass Medizintechnologien die Ambulantisierung deutlich fördern und deshalb eine sachgerechte Finanzierung der dafür notwendigen Sachkosten sichergestellt werden muss. Zugleich warnt der BVMed vor einer negativen Fallselektion, die durch unzureichende Vergütungsstrukturen entstehen könnte. Zudem sollen die Krankenhausreform und die Entwicklung einer sektorengleichen Vergütung besser aufeinander abgestimmt werden. Bevor eine flächendeckende Einführung der Hybrid-DRGs erfolgt, empfiehlt der Verband, die Modelle sorgfältig zu evaluieren und gegebenenfalls nachzusteuern, um eine faire und wirtschaftlich tragfähige Umsetzung zu gewährleisten.
Mehr zu den Themen Ambulantisierung, Krankenhausreform und Gesundheitsmarkt finden Sie auf unserer THEMEN– Seite! Abonnieren Sie auch unseren Newsletter und bleiben Sie auf dem Laufenden zu News & Jobs im Gesundheitswesen.
FAQ zur Ambulantisierung im Krankenhaus 2025

Der Schwerpunkt liegt auf Themen wie Krankenhausmanagement, Medizincontrolling, Digitalisierung und Gesundheitspolitik. Neben aktuellen Nachrichten und einem wöchentlichen Fach-Newsletter bietet medinfoweb ein spezialisiertes Stellenportal für Fach- und Führungskräfte im Klinikbereich.