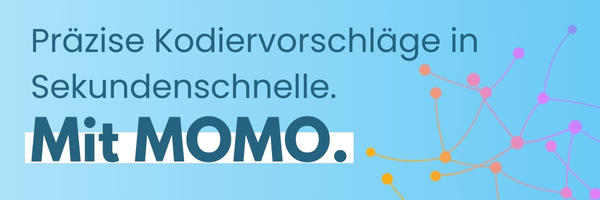Wirtschaftsrat der CDU e.V.: Für eine langfristige, nachhaltige Krankenhausplanung und -finanzierung
Eine effiziente Krankenhausversorgung, die auf den Prinzipien der Patientenorientierung, Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und Planungssicherheit basiert, bildet gemeinsam mit der ambulanten Versorgung das Fundament eines erstklassigen und verlässlichen Gesundheitssystems. Um dies auch in der Zukunft sicherstellen zu können, sind eine Neustrukturierung der Krankenhausversorgung sowie veränderte Finanzierungsstrukturen unabdingbar.
- Medizin
- Ökonomie
- Politik
Die Zahl der insolventen Krankenhäuser hat inzwischen ein erschreckendes Ausmaß angenommen. Nach einer aktuellen Umfrage der Unternehmensberatung Roland Berger unter 650 Klinikmanagern sehen mehr als die Hälfte die Liquidität ihrer Häuser als „gefährdet“ oder „stark gefährdet“ an. Nach dieser Selbsteinschätzung schrieben 70 Prozent der Kliniken in 2023 Verluste und 28 Prozent der Kliniken könnte bis zum Ende 2024 sogar die Insolvenz drohen.1 Angesichts der großen Bedeutung, die Krankenhäuser als Arbeitgeber haben, wäre dies nicht nur für die Versorgungssicherheit, sondern auch für die wirtschaftliche Sicherheit, insbesondere in peripheren Regionen, verheerend, da Krankenhäuser gerade außerhalb von Ballungsräumen wesentlich zur wirtschaftlichen Sicherheit der Region beitragen. Es ist zu erwarten, dass sich mit den aktuellen Planungen des Bundesgesundheitsministeriums die wirtschaftliche Situation der Krankenhäuser weiter verschärfen wird, so dass mit weiteren Insolvenzen und mit Versorgungseinschränkungen zu rechnen ist. Alle Reformvorhaben, insbesondere auch die Einführung von Vorhaltepauschalen, müssen zu einer finanziellen Stabilisierung der Krankenhäuser führen. Für die Transformation der Krankenhauslandschaft hin zu einer sektorenübergreifenden Struktur müssen ausreichende finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden.
Gleichzeitig dürfen die sinnvolle Spezialisierung und Leistungskonzentration nicht zur Gefährdung einer flächendeckenden und verlässlichen Versorgung führen. Gegebenenfalls bestehende regionale Unterschiede, insbesondere zwischen ländlichen Räumen und städtischen Ballungsgebieten, machen ein differenziertes Vorgehen erforderlich.
Zudem kann eine erfolgreiche Krankenhausreform nur gemeinsam mit allen Beteiligten gelingen. Insbesondere die Bundesländer müssen maßgeblich an der Umsetzung der Reform beteiligt werden, da sie die Versorgung in ihren Bundesländern steuern und verantworten. Gleichzeitig müssen alle Interessensgruppen, wie die Krankenkassen und die Krankenhäuser, sowie die Interessen der Patienten einbezogen werden.
1. Krankenhausfinanzierung sicherstellen und Strukturreform ermöglichen
Krankenhäuser brauchen eine leistungsgerechte, sichere und planbare Finanzierung, um eine qualitativ hochwertige Versorgung der Patienten anbieten zu können. Die aktuelle Vergütungssituation gefährdet zunehmend die wirtschaftliche Sicherheit der Krankenhäuser. Die durch Inflation und Personalkostensteigerungen verursachten finanziellen Belastungen sollten rückwirkend und zukünftig bei der Krankenhausfinanzierung berücksichtigt werden.
Jede Strukturreform ist mit Herausforderungen verbunden. Dies wird auch bei der Krankenhausreform der Fall sein. Eine kalte und unkontrollierte Strukturbereinigung sollte nicht zugelassen werden. Ein Vorschaltgesetz mit entsprechenden Finanzhilfen für die Krankenhäuser wäre der richtige Weg, um eine wirtschaftliche Stabilisierung der Krankenhäuser zu erreichen und die Insolvenzgefahr zu stoppen, bis eine solide Form der Krankenhausfinanzierung etabliert ist. Gleichzeitig müssen die Bundesländer ihren Investitionsverpflichtungen verlässlich nachkommen. Im Patienteninteresse darf es kein Ausscheiden von benötigten Leistungserbringern geben, solange sich nicht neue Formen der Versorgung verlässlich entwickelt haben. Dazu gehört auch die Möglichkeit, dass Patienten in oder an Krankenhäusern ambulant versorgt werden. Die Möglichkeit zur Erbringung dieser Leistungen sollte zwingend kurzfristig geschaffen werden, um die Versorgungssicherheit nicht zu gefährden. Die Ermächtigung von Institutsambulanzen bietet dabei einen Lösungsansatz.
Eine auskömmliche und verlässliche Finanzierung sollte nicht nur während der „Übergangsphase“ der Krankenhausreform sichergestellt sein. Die Fallpauschalen müssen für die Krankenhäuser auf Dauer wirtschaftlich und existenzsichernd sein, um die Überlebensfähigkeit der bedarfsnotwendigen Krankenhäuser und die Behandlungsqualität sicherzustellen. Die Vorhaltefinanzierung in ihrer jetzt vorgeschlagenen Form verbessert die finanzielle Situation der Krankenhäuser nicht. Unabhängig davon, welche Bemessungs- grundlage für die Finanzierung der Krankenhäuser herangezogen wird, ist wichtig: Für jeden Behandlungsfall ist eine auskömmliche Finanzierung sicherzustellen, inflationsbedingte Preissteigerungen und Personalkostensteigerungen müssen ausfinanziert werden. Um dies zu gewährleisten, sollte das Bundesministerium für Gesundheit vor jeder Änderung der Vergütungsstrukturen oder -mechanismen eine Folgenabschätzung durchführen. Ebenso wie die Bundesländer fordern wir eine nachvollziehbare Folgenabschätzung für das geplante System der Vorhaltevergütung, der Vergütungshöhe sowie der Tagesentgelte für sektorenübergreifende Versorgungseinrichtungen.
Schließlich muss die Trägervielfalt als wichtige und erfolgreiche Säule des Krankenhauswesens in Deutschland weiterentwickelt werden. Wir fordern gleiche Rahmenbedingungen und gleiche Spielregeln für alle Krankenhausträger bei der Finanzierung der Behandlungs- und der Investitionskosten; der Zugang zur Finanzierung muss für alle Träger gleich sein.
2. Krankenhäuser entbürokratisieren und eine outcome-orientierte Denkweise fördern
In unserem Gesundheitssystem dürfen Ressourcen nicht mehr im bisherigen Umfang für die Erfüllung von Dokumentationspflichten gebunden werden. Überbordende Bürokratie und überflüssige Strukturvorgaben belasten die Krankenhäuser zunehmend und verringern die notwendige Behandlungszeit durch Krankenhausfachkräfte. Nicht Bürokratie und fortgesetztes Hochschrauben der Strukturanforderungen, die an den ständig steigenden Behandlungskosten maßgeblich mitbeteiligt sind, sondern ergebnisorientierte Evaluation muss einen höheren Stellenwert erhalten, denn die Krankenhäuser haben ein hohes Eigeninteresse an der Sicherung der angebotenen Versorgungsqualität.
Gesetzliche Regelungen zu Personaluntergrenzen sowie Gesetze, die eine übermäßige Kontrolle der Häuser verlangen, müssen reduziert und angepasst werden. Ein verstärkter Fokus auf die Ergebnisqualität wäre dabei der richtige Weg. Für eine zukunftsfähige und finanzierbare Versorgung ist definitiv ein hohes Maß an Deregulierung gefragt.
3. Digitalisierung weiter vorantreiben und nutzen
Die Belange des Datenschutzes und das Recht der informationellen Selbstbestimmung der Patienten sind bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen zu berücksichtigen. Im Sinne des Patientennutzens und der Patientensicherheit sollten hier jedoch pragmatische Lösungen gefunden werden, um Digitalisierung u. a. zur Vermeidung von Behandlungsfehlern und damit zur Verbesserung der Versorgung zu nutzen. Zwingende Voraussetzung dafür ist eine konsequente und bürokratiearme Umsetzung der Digitalisierung in allen Krankenhäusern.
Eine weitere Voraussetzung ist die Interoperabilität von Anwendungen im Gesundheitswesen. Hierfür muss ein verpflichtender Standard für offene und diskriminierungsfreie Schnittstellen definiert werden, der auf offenen und internationalen Standardisierungsinitiativen basiert sowie einen systemneutralen Datenaustausch ermöglicht. Die Nutzung dieser Schnittstellen muss für alle Leistungserbringer, d.h. für Ärzte, Apotheken, Krankenhäuser, Rettungsdienste, Rehakliniken, Pflegeheime sowie auf mittlere Sicht auch für die Erbringer sonstiger medizinischer und pflegerischer Dienstleistungen vorgesehen sein. Angesichts der zunehmenden Bedeutung der digitalen Infrastruktur im Alltag ist es unerlässlich, dass die IT- Infrastruktur im Gesundheitswesen sicher gegen Cyberangriffe und andere böswillige Akteure entwickelt wird.
Im Zentrum des Transformationsprozesses stehen der Einsatz von KI sowie die Weiterentwicklung der Telemedizin. Diese gilt es im Krankenhausbereich nach einer Auswirkungsanalyse zügig und zielgerichtet verstärkt einzusetzen. Eine gezielte und rasche Umsetzung hätte nicht nur die Modernisierung der Krankenhäuser zur Folge, sondern auch die Erschließung von Einsparpotenzialen durch optimierte Prozesse.
Viele Digitalisierungsinvestitionen in eine moderne technische Ausstattung deutscher Krankenhäuser sind in den letzten Jahren nicht umgesetzt worden, weil die Krankenhäuser diese Maßnahmen nicht finanzieren konnten. Vor diesem Hintergrund sehen wir das Krankenhauszukunftsgesetz als notwendiges, aber nicht hinreichendes Gesetz zur Weiterentwicklung der Digitalisierung. Bei der Anschaffung von Software belaufen sich z. B. die Folgekosten für Service, Wartung, Updates etc. in den vielen Fällen auf 12 Prozent bis 20 Prozent des Kaufpreises der Lizenzen. Eine Finanzierung der Service- und Wartungskosten ist im Rahmen des Gesetzes nicht vorgesehen. Angesichts der Einsparpotenziale durch optimierte digitale Prozesse wäre die Übernahme eines Teils der Service- und Wartungskosten eine sinnvolle Maßnahme.
4. Fachkräftemangel bekämpfen
Aus der steigenden Lebenserwartung, Komorbiditäten und komplexen Therapieverfahren ergeben sich unterschiedliche Herausforderungen für alle in den Krankenhäusern tätigen Berufsgruppen. Die Personalgewinnung und -sicherung im ärztlichen und im pflegerischen Bereich ist weiterhin schwierig, mehr und mehr müssen sich die Krankenhäuser mit unterschiedlichsten Herausforderungen zur Besetzung und Wiederbesetzung von Personalstellen beschäftigen.
Insgesamt sind ein Ausbau der Ausbildungsangebote sowie Programme in den Schulen, die das Berufsbild der Gesundheitsberufe und deren Attraktivität vermitteln, notwendig. Zudem gilt es, die Anerkennungsverfahren für ausländische Fachkräfte einfacher und schneller zu gestalten. Wir fordern u.a. eine schnelle und vereinfachte Anerkennung der Berufsabschlüsse von Gesundheitsfachkräften aus Ländern, in denen ein gutes Ausbildungsniveau vorhanden ist. Gegebenenfalls könnte hierbei eine bundesweite Zentralisierung der Anerkennung von Berufsabschlüssen und Diplomen ausländischer Fachkräfte sowie bundeseinheitliche Kurrikula und Abschlüsse bei der Weiterbildung die Prozesse unterstützen. Dazu ist auch die Digitalisierung der Ausländerbehörden zur Beschleunigung der Verfahren notwendig.
Zudem ist eine Steigerung der Attraktivität der Gesundheitsberufe erforderlich. Dazu können u.a. durchlässige Qualifikations- und Weiterqualifizierungsmaßnahmen beitragen. Auch das Nutzen der Digitalisierungspotentiale (inkl. entsprechender Weiterbildungen in diesem Bereich), der Ausbau und die Flexibilisierung der Kinderbetreuungszeiten in Kindereinrichtungen oder die Förderung des Verbleibs sowie des Wiedereinstiegs in den Beruf können die Attraktivität steigern. Auch die Endbürokratisierung in den medizinischen Bereichen, weg von den Dokumentationspflichten hin zu mehr Zeit für die Patienten, würde zur Attraktivität beitragen.
Innovative Dienstplanmodelle sind notwendig, um eine verlässliche und qualitativ hochwertige Versorgung der Pflegebedürftigen zu gewährleisten. Die derzeitige Dienstplangestaltung leidet unter restriktiven Arbeitszeitgesetzen. Flexiblere Arbeitszeiten sind jedoch aufgrund der Natur der Branche unerlässlich. Auch für die Beschäftigten ist es attraktiver, wenn sie flexibel entscheiden können, wie lange und wann sie arbeiten. Starre Arbeitszeitgesetze sind angesichts des Fachkräftemangels nicht mehr zeitgemäß, und eine Flexibilisierung der Arbeitszeitgesetze in der Pflege ist ein notwendiger Schritt für einen effizienten Personaleinsatz und mehr Qualität in der Pflege. Daneben muss die Substitution insbesondere ärztlicher und pflegerischer Tätigkeiten durch jeweils andere Berufsgruppen dringend in Angriff genommen werden. Hier wird vorhandenes Potential bisher nur unzureichend genutzt.
5. Sektorenüberengreifende Behandlungsabläufe ausbauen
Nur durch eine stärkere Verzahnung ambulanter, teilstationärer und stationärer Versorgung ist eine nachhaltige patientenorientierte Versorgung erreichbar. Gleichzeitig sind Vielfalt in der Versorgung sowie kurze Wege für die Patienten sicherzustellen. Prozessorientierte Versorgungsketten müssen auf Basis von Krankheiten und Diagnosen an die Stelle der aktuell an Sektoren ausgerichteten Einzelleistungen treten.
Eine sektorenübergreifende Versorgung benötigt zudem ein sektorenübergreifendes Vergütungssystem. Daher wäre der Übergang vom gegenwärtigen, sektoralen System hin zu einem patientenorientierten Vergütungssystem richtungsweisend.
Die Pläne der Ampelkoalition zur Einführung von Level-1i-Krankenhäusern sind derzeit völlig unausgereift. Die Grundidee, den Krankenhäusern stationäre und ambulante Behandlungsleistungen zu ermöglichen, ist jedoch richtig. Ein Zugang für die Krankenhäuser in die ambulante Versorgung und eine auskömmliche Vergütung über die Sektorengrenzen hinweg muss zwingend sichergestellt werden. Eine schnelle Umsetzungsmöglichkeit könnte z.B. die flächendeckende Zulassung von Institutsambulanzen an Krankenhäusern analog der Ermächtigung der Hochschulambulanzen an den Universitätsklinika bieten.
Berlin, im August 2024
1 Roland Berger, Krankenhausstudie 2024, Quelle: https://content.rolandberger.com/hubfs/07_presse/24_2289_MMP_German_Hospital_Study_2024_final.pdf
Wirtschaftsrat der CDU e.V.
Luisenstr. 44, 10117 Berlin
Telefon: 0 30 / 240 87-216
E-Mail: gesundheit@wirtschaftsrat.de
wirtschaftsrat.de

Gebündelt, stets aktuell und immer handverlesen werden alle Neuigkeiten gesammelt und anwenderbezogen aufbereitet.