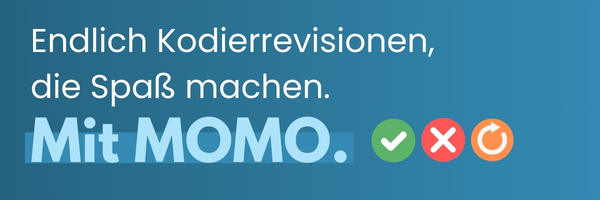Zwischen Diagnosehilfe und Vertrauenslücke: KI im Klinikalltag
Künstliche Intelligenz hat sich von der Alltagsanwendung zur ernstzunehmenden medizinischen Unterstützung entwickelt. In Radiologie, Chirurgie, Therapieplanung und Forschung wird sie zunehmend eingesetzt. Systeme erkennen Tumore auf Bildaufnahmen, erstellen Behandlungspläne, koordinieren Termine und unterstützen im Operationssaal. Innovative Ansätze, wie mehrsprachige Aufklärungs-Avatare, sollen Arzt-Patienten-Gespräche vertiefen.
- IT
- Medizin
- QM
Die Bundesärztekammer sieht die Medizin an einem Wendepunkt. Verbesserte Diagnostik, personalisierte Therapien und optimierte Abläufe könnten die Versorgung deutlich verändern. Der Deutsche Ethikrat betont Chancen, warnt aber vor Blackbox-Entscheidungen, Manipulationsrisiken und möglichem Kompetenzverlust bei medizinischem Personal.
Ethische und rechtliche Fragen bleiben ungelöst, vor allem in Haftungsfragen. Fachleute fordern deshalb geprüfte und zertifizierte Anwendungen sowie klare Einsatzgrenzen. Datenschutz, Unabhängigkeit von wirtschaftlichen Interessen und Erhalt ärztlicher Entscheidungskompetenz gelten als zentrale Voraussetzungen.
Ein Beispiel aus der Intensivmedizin zeigt, dass KI Arbeitsprozesse beschleunigen und entlasten kann. Dennoch bestehen Vorbehalte, auch bei Patient:innen. Studien belegen, dass Mediziner:innen mit KI-Nutzung als weniger kompetent und empathisch wahrgenommen werden.
Expert:innen empfehlen, Vorteile aktiv zu kommunizieren und Ängste abzubauen. Ziel müsse eine bessere Behandlungsqualität sein. Effizienzgewinne sollten nur als Mittel zum Zweck dienen.
deutschlandfunk.de